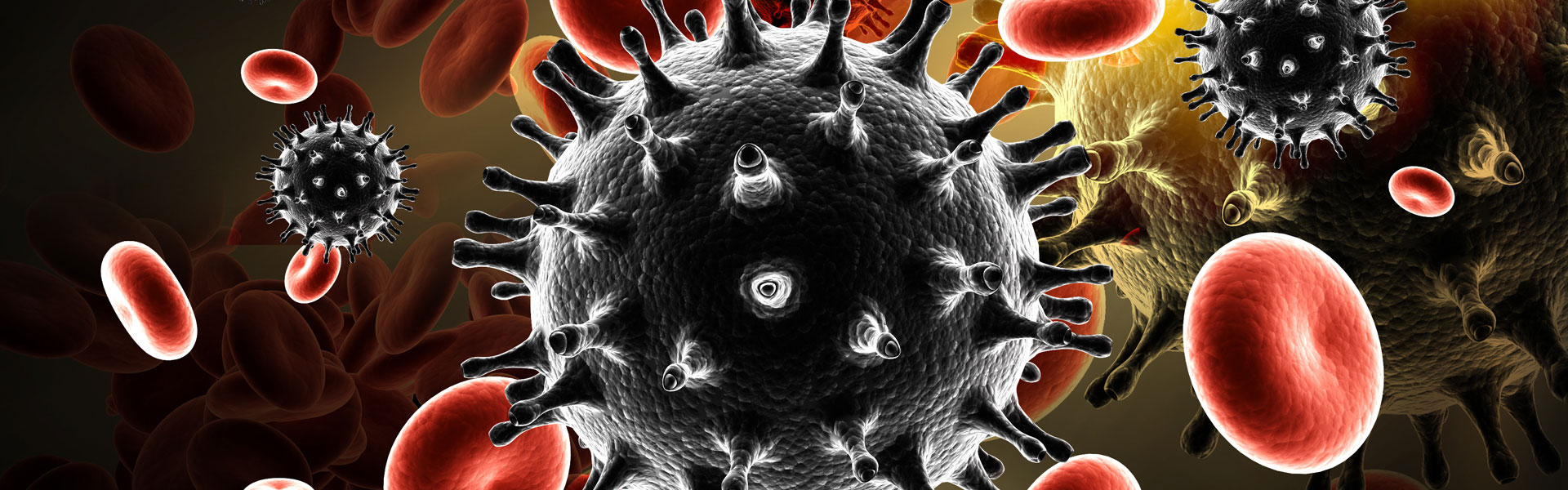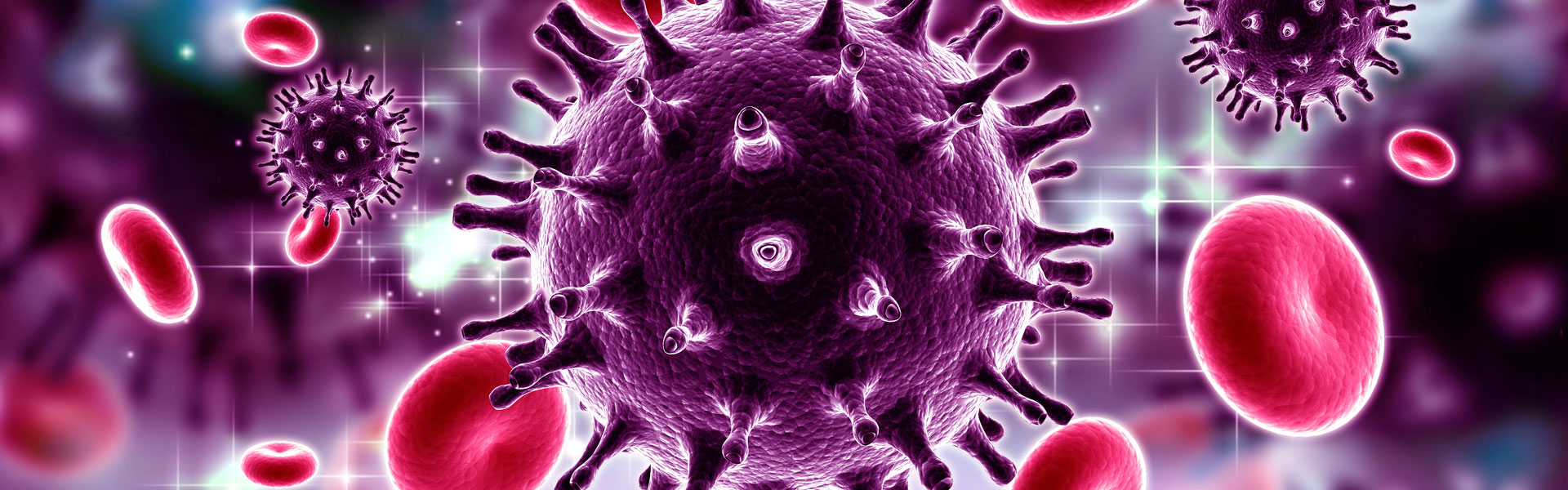„Einige vektorübertragene Infektionskrankheiten haben großes Potenzial, Pandemien auszulösen“
Bevor Impfstoffe für Menschen zugelassen werden, haben sie bereits einen langen Weg in der experimentellen Forschung zurückgelegt. Inwiefern es hier neue Ansätze für die Verbesserung von Impfstoffen gibt erzählt uns Prof. Dr. Asisa Volz von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten leitet die Virologin die Nachwuchsgruppe ZooVac, die an Impfstoffen forscht. Darüber hinaus ist sie Teil des Verbundes RAPID.
Vektor-Impfstoffe waren unter den ersten wirksamen Impfstoffen gegen COVID-19 – und damit auch überhaupt unter den ersten Impfstoffen gegen eine durch ein Coronavirus ausgelöste Krankheit. Hat Sie überrascht, dass wirksame Impfstoffe innerhalb dieser kurzen Zeit entwickelt wurden?
Nein, überrascht war ich nicht. Die Vektortechnologie gibt es seit Jahrzehnten. Der Erfahrungsschatz bezüglich dieser Impfstoffe ist sehr groß. Sie wurden auch bereits in verschiedensten Infektionsmodellen getestet und dadurch eine Art Plattform aufgebaut, so dass man nur noch das entsprechende Pathogen austauscht. Da die Plattform also bereits etabliert ist, müssen dann, nach Anpassung oder Austausch des Pathogens, nur noch alle Versuche und Qualitätskontrollen abgearbeitet werden, die notwendig sind, um die Sicherheit, Wirksamkeit und Immunogenität des Impfstoffs zu testen.
Und die Plattform ist in diesem Fall ein Adenovirus …
Das Adenovirus war hierfür prädestiniert, da es sich als Vektor gegen das MERS-Coronavirus als geeignet herausgestellt hat. Dementsprechend waren bereits die Systeme etabliert, nur noch das Impfantigen musste ausgetauscht werden.
Einen Impfstoff gegen das MERS-Coronavirus hatten Sie bereits vor einiger Zeit entwickelt.
Genau, und dieser Impfstoff wird innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten im Verbund RAPID beforscht. In einem Vorversuch hatten wir den MVA-MERS-S-Impfstoff in Kamelen getestet. Dort konnten wir zeigen: Der Impfstoff schützt im Kamel gegen die MERS-Infektion. Mit dem RAPID-Konsortium haben wir die Forschung ausgeweitet, sodass wir mit dem Impfstoff von der experimentellen Anwendung in die Feldforschung gehen. In Kooperation mit dem zentralen Veterinärlabor in Dubai konnten wir so erste Versuche mit dort lebenden Kamelen machen. Durch die aktuelle Pandemie ist diese Forschung leider eingeschränkt und verzögert. Aber die ersten Versuche zeigten, dass der Impfstoff auch in Kamelen in Zuchtanlagen eine Immunantwort induziert.
Und für diesen Impfstoff verwendeten Sie auch das Spikeprotein des MERS-Coronavirus, wie aktuell bei den SARS-CoV-2-Impfstoffen das Spikeprotein eingesetzt wird?
Ja, das Spikeprotein spielt bei der Immunantwort eine entscheidende Rolle.
Können Sie kurz ausführen, um was es sich beim MVA-Virus handelt?
MVA-Virus steht für Modified-Vaccinia-Ankara-Virus und ist ein attenuiertes, also abgeschwächtes Vacciniavirus. Das Vacciniavirus ist als der Prototyp eines Lebendimpfstoffes bekannt, der sehr erfolgreich eingesetzt wurde, um die Menschenpocken auszurotten. In diesem Fall wurde das Vacciniavirus Ankara auf Hühnerzellen passagiert und hat dadurch seine ursprüngliche Vermehrungsfähigkeit in Säugetieren verloren, es wurde also modifiziert. Das MVA-Virus hat sich als vielversprechender Impfvektor bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen verschiedenste Infektionserreger etabliert. Das MVA-Virus als Impfvektor wurde von Prof. Gerd Sutter an der Ludwig-Maximilians-Universität München entwickelt.
MERS und SARS werden auf einer Liste der WHO weiterhin als einige der gefährlichsten Infektionskrankheiten geführt. Haben diese Erkrankungen jetzt durch die Entwicklung der Impfstoffe ihren Schrecken verloren?
Soweit würde ich nicht gehen. Nach wie vor müssen wir diese Coronaviren genau beobachten und weiterhin erforschen. Wir haben bei SARS-CoV-2 ja gerade gesehen, wie schnell sich verschiedene Varianten bilden können. Das könnte uns auch mit MERS-CoV passieren. Es gibt zwar jetzt gute Impfstoffe und auch antivirale Wirkstoffe, wir dürfen diese Erreger aber nicht unterschätzen, um für zukünftige Entwicklungen gewappnet zu sein. Die COVID-19-Pandemie hat uns eher gezeigt, dass wir vorsichtig sein müssen.
ZooVac hatte sich vor der aktuellen Pandemie mit dem Zika-Virus beschäftigt. Wird hier weiter an einem Impfstoff geforscht?
Zwar hatten wir, wie alle anderen auch, Einschränkungen hinsichtlich der Pandemie, dennoch haben wir hier auf Hochtouren weiter daran gearbeitet. Zika ist nach wie vor eine sehr wichtige Zoonose. Gerade wenn man berücksichtigt, dass dies eine vektorübertragene Infektionskrankheit ist. Hier gibt es ein großes Potenzial an Pandemien. Das Zika-Virus kommt aus der Familie der Flaviviren. Und diese Familie beherbergt so einige prominente Vertreter, die über Mücken übertragen werden, wie etwa das West-Nil-Virus oder das Dengue-Fieber-Virus, das vielleicht bei uns in Europa aktuell keine Rolle spielt, jedoch weltweit bedeutend ist. Wir können auch noch nicht in Gänze abschätzen, wie sich die Klimaerwärmung auf das gesamte System auswirkt, sodass entsprechende Vektoren eventuell auch bei uns heimisch werden. Es ist daher sehr wichtig, dass Zika-Virus als Modell anzusehen und anhand dieses Modells zu untersuchen, wie man bessere Impfstoffe gegen solche zoonotischen Erreger entwickeln kann. Darüber hinaus können wir mit diesem Modell unterschiedliche virologische Fragestellungen zur Impfstoffentwicklung untersuchen.
Welche Fragestellungen wären das beispielsweise?
Das Zika-Virus führt zu neurologischen Erkrankungen bei Neugeborenen und in seltenen Fällen auch bei Erwachsenen. Hier kann man also untersuchen, was ein Impfstoff mit sich bringen muss, um gezielt einen neurologischen Schutz zu induzieren. Weiterhin hat das Zika-Virus die Komponente, dass schwangere Frauen vermehrt von negativen Auswirkungen betroffen waren, da das Virus auf den Fötus übergegangen ist. Hier ist also die Frage: Wie muss ein Impfstoff aussehen, der auch das ungeborene Kind schützen kann? Ein Impfstoff also, den man während der Schwangerschaft sicher anwenden kann und der einen Schutz für den Fötus bietet. Was wir bei Zika auch gesehen haben: Das Virus hat sich vor dem Hintergrund von Fußball-WM und Olympischen Spielen 2014 massiv schnell ausgebreitet. Was muss ein Impfstoff mit sich bringen, um schnell eine protektive Immunantwort hervorzurufen, ist also eine weitere Frage.
Wie weit sind Sie mit der Entwicklung eines Zika-Impfstoffes?
In der Nachwuchsgruppe ZooVac haben wir einen experimentellen Ansatz gewählt, unsere Forschung ist also nicht gezielt auf klinische Entwicklung ausgelegt. In unserer Forschung sind wir schon gut fortgeschritten. Mehrere unserer Impfstoffkandidaten sehen bereits sehr vielversprechend aus.
Bei ZooVac geht es auch um die Verbesserung von Impfstoffen. Wie verbessert man einen Impfstoff?
Wir haben einen neuen Ansatz gewählt, in dem wir nicht im Sinne einer klassischen Impfstoffentwicklung nur die Strukturantigene als Impfantigene auswählen, sondern unseren Hauptfokus auf die sogenannten Nichtstrukturproteine gelegt haben. In der Regel sind solche Strukturproteine auch mal schnell anfällig für Mutationen. In unserem Zika-Impfstoff-Ansatz wollen wir gezielt andere Proteine testen. Beispielsweise solche, die näher am Kern des Virus liegen, da diese in der Regel weniger anfällig für Mutationen sind. Unser Ziel war es also nicht so sehr auf die Aktivierung von Antikörpern zu gehen, sondern eher auf die Aktivierung von T-Zellen, um eine anders wirksame Immunität hervorzurufen. Und das ist das wirklich Spannende: Wir haben hier tatsächlich gesehen, dass es mehrere Nichtstruktur-Proteine des Zika-Virus gibt, die einen wirksamen Impfschutz induzieren. Ich denke, dass man unsere Daten verwenden kann, um gezielt andere Impfstoffe zu verbessern.
Es geht also um eine qualitative Verbesserung im Sinne einer besseren Wirksamkeit?
Eher um eine andere Wirksamkeit. Also nicht den klassischen Ansatz zu wählen, so viele neutralisierende Antikörper wie möglich hervorzurufen, sondern auch eine gute T-Zell-Antwort zu induzieren. Somit von einer anderen Seite noch einen guten Schutz aufzubauen, vor dem auch das Virus nicht so leicht durch Mutation entfliehen kann.
Wie werden diese Impfstoffe konkret getestet?
Gerade beim Zika-Virus gibt es ein sehr gutes Mausmodell. Natürlich sind Mäuse keine Menschen, aber wir befinden uns mit unserer Forschung, wie bereits erwähnt, im experimentellen Bereich. Das Mausmodell bietet uns zahlreiche Tools, den Impfstoff in der Maus zu charakterisieren und daraus dann entsprechende Schlüsse zu ziehen. Wir haben mittlerweile eine Art Bibliothek an Impfstoffen entwickelt und diese im Mausmodell getestet. Auf die immer gleiche Art, um dann festzustellen, wie die unterschiedlichen Proteine wirken. So werden Unterschiede schnell sichtbar. Das Mausmodell macht unsere Forschung extrem flexibel.
Im Vorgang der Impfstoffentwicklung ist die geimpfte Dosis ja von entscheidender Bedeutung. Wie bestimmt man die „richtige“ Dosis?
Unsere Grundlage ist die Erfahrung, die wir mit unserem MVA-Impfstoff haben, also historische Daten, die wir von den Pockenimpfstoffen kennen. Eine bestimmte Anzahl der Erfahrungswerte testet man im Mausmodell. Die beste Dosis wird dann wiederum im nächsten präklinischen Modell getestet. Aus diesen kumulativen Daten erfolgt gemeinsam mit den Klinikern die Überlegung, welche Dosis im Menschen getestet wird. Mit dieser genauen Menge wird dann auch der Antrag zur klinischen Testung beim Paul-Ehrlich-Institut gestellt. Im klinischen Versuch, also noch weit vor der Zulassung, lässt sich dann erneut herausfinden, welche Dosis am besten geeignet ist. Das Gleiche gilt übrigens für die Applikationsrouten (also intramuskulär, oral oder intranasal). So hat man bei jedem Impfstoff bestimmte Erfahrungswerte, die man zunächst im Tiermodell testet, um die Ergebnisse dann im klinischen Versuch zu bestätigen.
Das Gespräch führte Christoph Kohlhöfer.