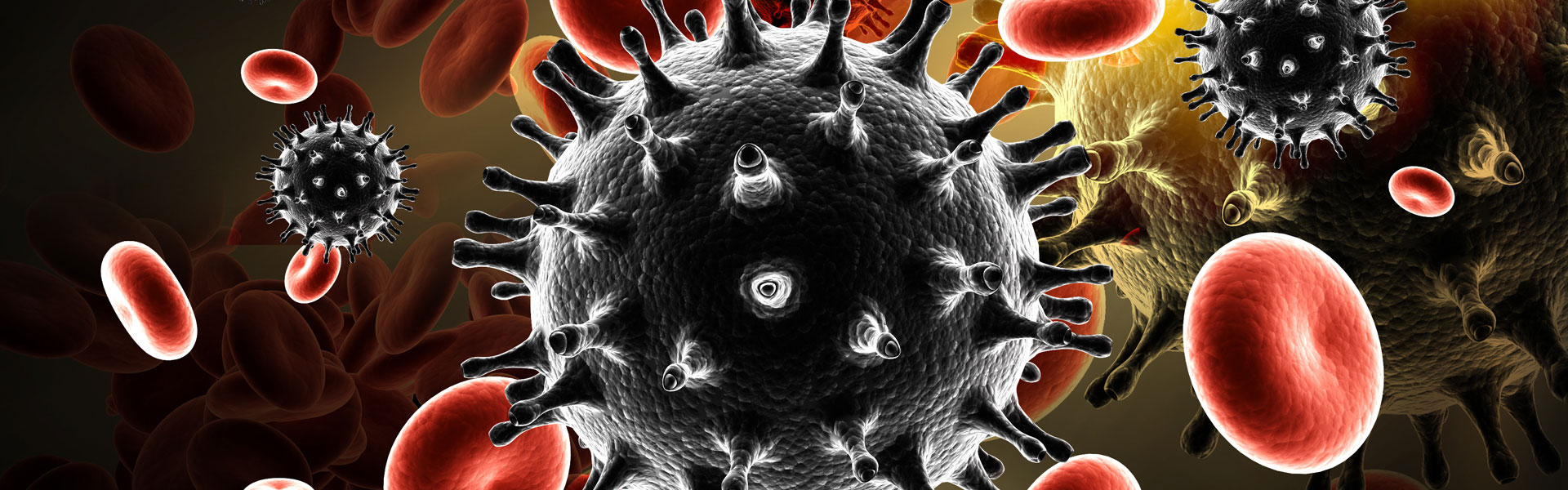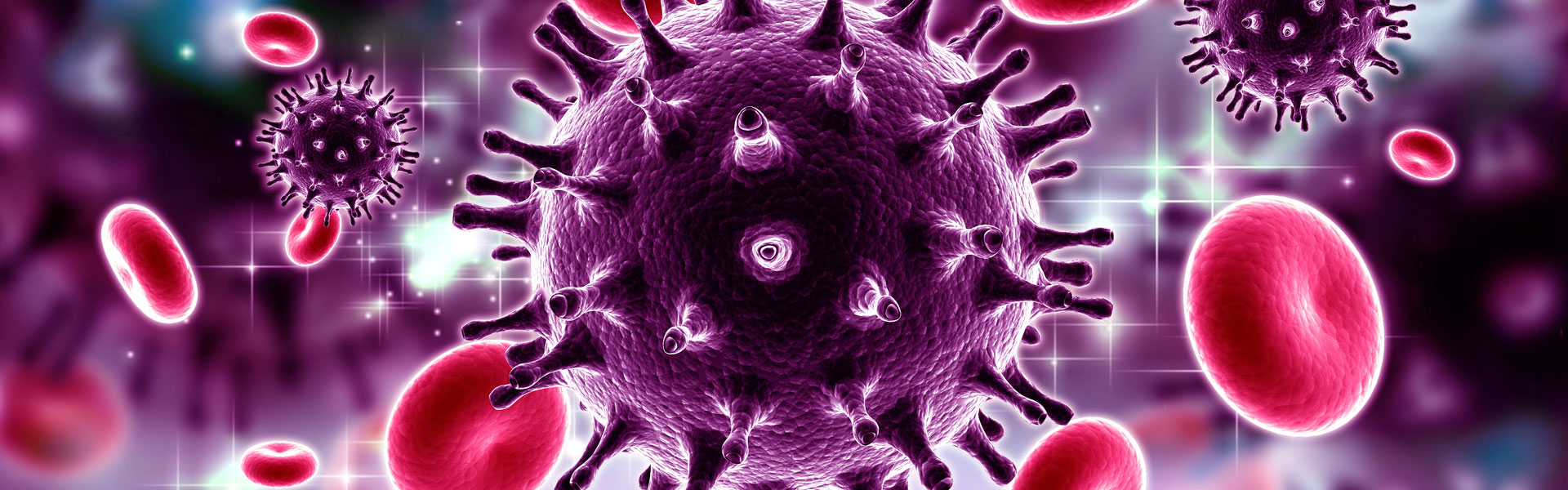7 Fragen an … PD Dr. Bernd-Alois Tenhagen
PD Dr. Bernd-Alois Tenhagen forscht am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Zum gesetzlichen Auftrag des unabhängigen Instituts gehört die gesundheitliche Bewertung der Sicherheit von Lebensmitteln. Innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten ist Dr. Tenhagen Teil des interdisziplinären Verbunds #1Health-PREVENT.
Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt innerhalb des Verbundes #1Health-PREVENT?
Wir arbeiten am BfR vor allem an der Relevanz von multiresistenten Erregern in den verschiedenen Lebensmittelketten vom Stall bis auf den Teller. In #1Health-PREVENT befassen wir uns mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) in der Lebensmittelkette Milch. Das betrifft zum einen Faktoren, die die Verbreitung von MRSA in den Milchviehherden beeinflussen und zum anderen Konsequenzen für die Herstellung von Rohmilchprodukten.
Bei Nutztieren werden multiresistente Erreger vor allem in intensiven Tierhaltungen angereichert und verbreitet. Gibt es hier signifikante Unterschiede zwischen den Arten der Nutztiere?
Ja, sogar große. So finden wir MRSA häufig in Schweine-, Mastputen- und Kälbermastbetrieben, während sie beim Hähnchen und beim Rind eher selten im Bestand gefunden werden. Escherichia coli und Campylobacter sind dagegen besonders häufig beim Masthähnchen resistent. Letztlich wird in den Beständen viel vom Antibiotikaeinsatz beeinflusst, sowohl was die Häufigkeit von multi-resistenten Erregern (MRE) angeht als auch was die Frage angeht, gegen welche AB die Bakterien resistent sind. Der Einsatz von Antibiotika ist vor allem in der Hähnchenhaltung sehr hoch.
Machen sich diese Unterschiede auch im Fleisch, das der Verbraucher im Supermarkt kauft, bemerkbar?
Zwischen dem Stall und dem Supermarkt liegt der Schlachthof. Die Bakterien auf dem Lebensmittel sind in weiten Teilen ein Spiegel der Bakterien in den Tierbeständen. Auf dem Schlachthof wird aber beeinflusst, wie viele der Bakterien auf dem Fleisch landen und in wieweit die Bakterien auch von Tieren anderer Betriebe stammen, die vorher geschlachtet wurden. Hier gibt es sowohl zwischen den Tierarten und Nutzungsrichtungen (beim Geflügel wird mehr übertragen als bei Rind und Schwein) als auch zwischen den Schlachthöfen, die dieselben Tierarten schlachten, erhebliche Unterschiede.
Welche Rolle spielen Lebensmittel bei der Ausbreitung von MRE beim Menschen?
Das hängt von der betrachteten Bakterienart ab. Bei den klassischen Erregern Lebensmittel-bedingter Zoonosen, wie Salmonella und Campylobacter finden wir die Resistenzmuster aus den Tierhaltungen auch bei den Infektionen des Menschen wieder, weil es ja diese Erreger von den Tieren sind, die die Infektionen des Menschen hervorrufen. Bei Bakterien, die wir eher zur Normalflora von Tieren und Menschen zählen, wie Escherichia coli, stellt sich die Situation komplexer dar, weil sich eine mögliche Übertragung nicht so unmittelbar in Infektionen widerspiegelt. Hier ist aber Konsens, dass der größte Teil der Infektionen mit diesen MRE nicht durch MRE von Tieren oder Lebensmitteln, sondern durch Übertragungen von Mensch zu Mensch verursacht wird. Wenn man den relativen Anteil beschreibt, ergibt sich der Effekt, dass, je besser die Vorbeugung im humanmedizinischen Bereich funktioniert, desto größer wird der relative Anteil der Tierhaltung an der Problematik.
Bei den MRSA sind es ganz bestimmte Bakterienstämme, die wir den Tieren zuordnen können. Dadurch wissen wir, dass etwa 3-8 % der humanen MRSA Isolate, die an das Nationale Referenzzentrum des RKI geschickt werden, zu diesen Tierstämmen zählen (92-97 % also nicht vom Tier stammen). Das kann regional aber stark variieren, abhängig davon, wie bedeutsam die Tierhaltung in einer Region ist.
Können MRE auch in die Milch gelangen und so auf den Menschen übertragen werden?
Ja, können Sie. Es ist auch seit langem die Position des BfR, dass Milch aus Gründen des Infektionsschutzes nicht roh verzehrt werden soll. Bei der üblicherweise vermarkteten pasteurisierten oder hocherhitzten Milch spielen MRE aber keine Rolle mehr, weil sie wie andere Bakterien durch die Hitze abgetötet werden.
Welche anderen Wege – außer den Lebensmitteln – gibt es für MRE, um von Tieren zum Menschen zu kommen?
Der wichtigste Übertragungsweg ist der direkte Kontakt zwischen Tieren und Menschen. Dabei erfolgt die Übertragung in beiden Richtungen, d.h. aus dem Krankenhaus oder dem Ausland mitgebrachte MRE können vom Menschen auf Haustiere übertragen werden und Stämme aus Tierkliniken oder der landwirtschaftlichen Tierhaltung können von den Tieren auf Menschen übertragen werden. Betroffen sind davon vor allem die HalterInnen der Tiere. Durch die wechselseitige Übertragung müssen auch immer beide Seiten betrachtet werden, wenn man solche Besiedlungen und Infektionen wirksam bekämpfen will.
Können Verbraucher etwas tun, um der Ausbreitung von MRE in Lebensmitteln entgegenzuwirken bzw. sich vor der Aufnahme der Keime zu schützen?
Das Zauberwort heißt Küchenhygiene. Wie bei der Milch, gilt auch beim Fleisch, dass die relevanten Bakterien durch die Erhitzung wirksam abgetötet werden. Das Hauptrisiko – neben dem Rohverzehr von Fleisch – liegt in der Übertragung der Keime von dem noch nicht erhitzten Fleisch auf andere Lebensmittel, die roh verzehrt werden (z.B. Salat). Dies kann über die Hände, über Küchenutensilien (Schneidbretter, Messer etc.) aber auch z.B. über Spritzwasser erfolgen. Weil die Küchenhygiene so wirksam ist, hat das BfR auch entsprechende Verbrauchertipps herausgegeben, die auf der Website des BfR verfügbar sind. Diese Maßnahmen gelten sowohl für MRE als auch für nicht resistente Krankheitserreger.
Ein weiterer, aber weniger wirksamer Weg ist, tierische Produkte aus ökologischer Haltung zu kaufen, weil diese oft weniger MRE enthalten. Allerdings wird das Risiko dadurch nur geringfügig reduziert, so dass die Bedeutung der Küchenhygiene erhalten bleibt.
Das Gespräch führte Christoph Kohlhöfer