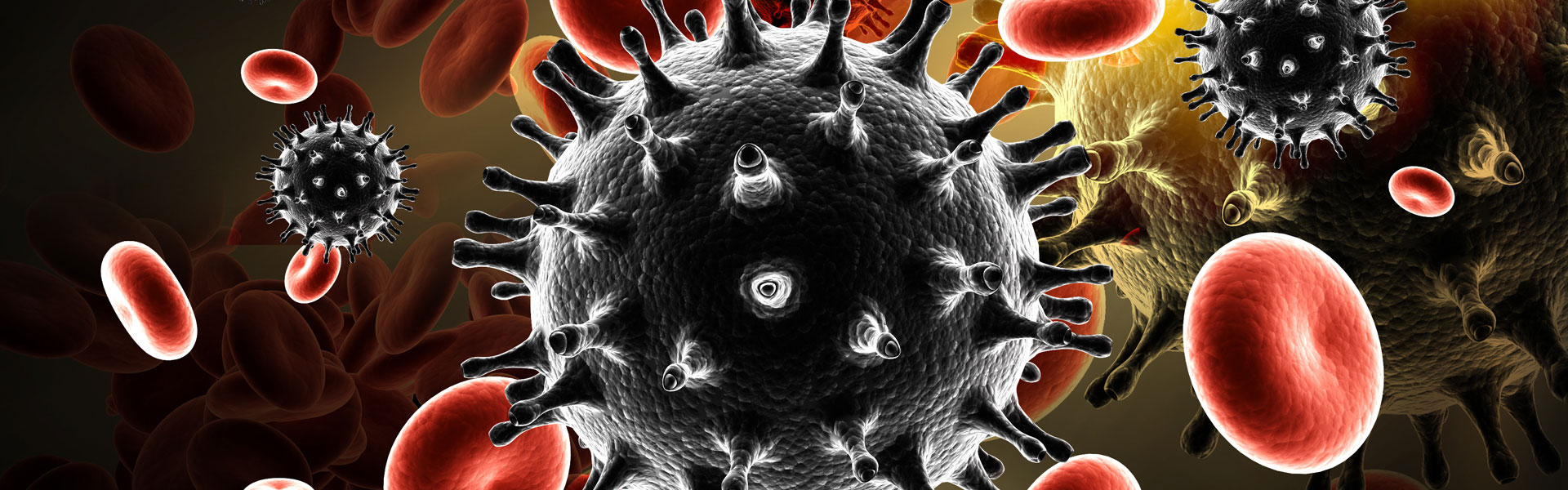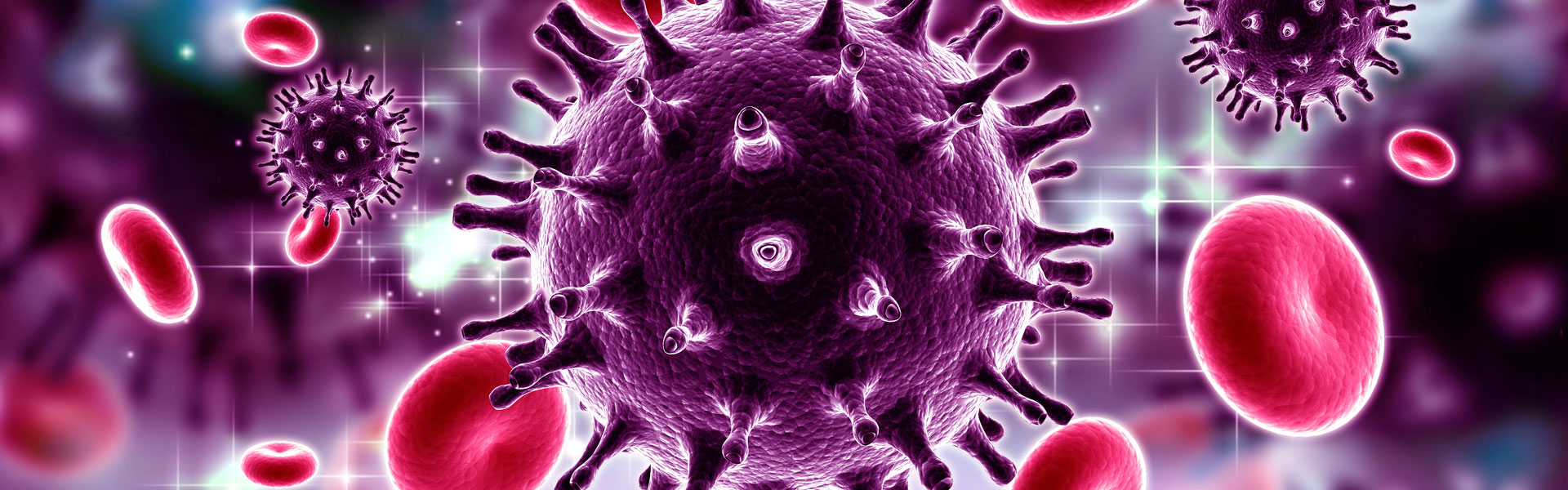Viren, die das West-Nil-Virus unterdrücken könnten
Lange gab es in Europa keine West-Nil-Virus-Fälle. In den letzten Jahren hat sich das allerdings geändert, zuerst in Südeuropa. Seit 2019 treten aber auch in Deutschland Fälle bei Menschen auf, der Erreger ist hier endemisch geworden. Es infizieren sich mittlerweile also auch Menschen mit dem West-Nil-Virus, die keine Reise gemacht haben. Die Virensequenzen der hier auftretenden Fälle ähneln sich, so dass man annimmt, dass das Virus nicht jeweils neu eingeschleppt wurde – denn dann würden sich die Sequenzen deutlicher unterscheiden. Trotz dieser Ausgangslage ist die bisherige Datenlage in Deutschland noch dünn. Das gilt besonders für Stechmücken, die mit sogenannten Insekten-spezifischen Viren infiziert sind, also mit Viren, die nur Stechmücken und nicht den Menschen infizieren können. Interessant ist das, weil manche dieser Insekten-spezifischen Viren in der Lage sind, eine Infektion von Stechmücken mit dem West-Nil-Virus zu unterdrücken und damit dessen Verbreitung stark beeinflussen. Das Verbundprojekt „Inhibition der vektoriellen WNV-Übertragung durch insekten-spezifische Viren“, das Prof. Dr. Sandra Junglen an der Charité in Berlin leitet, befasst sich mit der Frage, wie welchen Einfluss in Deutschland vorkommende Insekten-spezifische Viren auf die Übertragbarkeit von West-Nil-Virus durch Stechmücken haben.
Insekten-spezifische Viren sind Viren, die nur Insekten infizieren. Sie können Arboviren, wie etwa das West-Nil-Virus, hemmen – so dass diese in Insekten schlechter replizieren oder manchmal sogar gar nicht mehr übertragen werden. Es scheint so, dass dieser Vorgang an ein spezifisches Pärchen gebunden ist: Dass also ein spezifisches Arbovirus mit einem bestimmten Insekten-spezifischen Virus interagiert und dass diese Interaktion zudem auch noch von der Mückenart abhängt. Teilweise funktioniert diese Übertragungshemmung sehr gut. Das Problem: Bisher gibt es dazu keine Daten aus Deutschland.
So ist nach wie vor sehr wenig darüber bekannt, welche Insekten-spezifischen Viren hierzulande vorkommen und was diese dann genau tun. „Und das wollen wir ändern“, sagt Prof. Sandra Junglen, die an der Charité in Berlin forscht. Dazu werden alle Mücken, die im Osten Deutschlands, dort wo das West-Nil-Virus auftritt, gesammelt wurden, auf Virusinfektionen getestet - jede einzeln. In Surveillance-Projekten werden Mücken üblicherweise in großen Pools getestet, was Arbeit spart. Das Problem an dieser Vorgehensweise ist, dass sie für die aktuelle Fragestellung wenig aussagekräftig ist. Findet man Erreger im Pool, weiß man nie, ob die Mücke mit einem oder mehreren Erregern infiziert ist. „Wir testen daher jedes Tier einzeln“, sagt Junglen, „um später eine Gewissheit darüber zu haben, welche Viren zusammen vorkommen - oder bei welchen das eben ausgeschlossen ist.“ In der Zellkultur wird anschließend geprüft, ob nachgewiesene Insekten-spezifischen Viren einen Einfluss auf die Replikation des West-Nil-Virus haben.
Bisher ist nicht klar, welche Insekten-spezifischen Viren in der Lage sind, das West-Nil-Virus zu unterdrücken. Zwar gibt es Nachweise zur Unterdrückung der West-Nil-Virus Replikation durch Flaviviren, aber die Datenlage ist bisher dünn. Bei manchen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass diese Viren das West-Nil-Virus, ebenfalls ein Flavivirus, inhibieren – so dass manche Forschende davon ausgehen, dass der Prozess bei verwandten Viren innerhalb des Genus Flavivirus auftritt. Anderseits haben andere Untersuchungen diesen Effekt bisher nicht nachgewiesen. Weiterhin ist der Mechanismus der Unterdrückung bisher komplett unklar.
Wüsste man das, wäre das ein großer Schritt auf dem Weg zu einer neuen Methode der Pathogenbekämpfung und -prävention. Der bisherige Weg sieht im Wesentlichen vor, möglichst viele Mücken zu eliminieren: Durch die Trockenlegung ihrer Lebensräume, durch Sterilisation, durch Vergiften. Diese Methoden sind jedoch nicht zuverlässig und haben mehr oder weniger große Nachteile für den Rest des Ökosystems.
Insekten-spezifische Viren kommen hingegen natürlicherweise vor. Wenn ein Insekten-spezifisches Virus die Infektion mit West-Nil-Virus unterdrücken kann, wird die Verbreitung des Erregers eingedämmt. Man könnte in Zukunft also auch Mücken mit einem Insekten-spezifischen Virus infizieren - wodurch dann das West-Nil-Virus nicht mehr übertragen wird. Das langfristige Ziel ist daher, die gewonnenen Daten so einzusetzen, dass Infektionskrankheiten zurückgedrängt werden können, die durch Mücken übertragen werden - ohne dem Ökosystem zu schaden. Im Idealfall funktioniert das auch bei anderen Pathogenen.
Bisher hat das Team um Junglen tausende Mücken aufgearbeitet und getestet. Sie haben eine Vielzahl an Insekten-spezifischer Viren gefunden, das West-Nil-Virus nachgewiesen und diese Viren in Zellkultur angezüchtet. Im nächsten Schritt stehen Infektionsexperimente an, in denen die Interaktion der Viren in der Zellkultur untersucht wird. Idealerweise versucht man dabei auch den Mechanismus der Co-Infektion zu verstehen. Junglen sagt: „An dieser Stelle stehen die Versuche jetzt.“
In Deutschland wurde so etwas noch nicht untersucht. Auch international gibt es nur wenige Studien, die Infektionen und Co-Infektionen von Insekten-spezifischen Viren und dem West-Nil-Virus untersuchen. Die Daten, die bisher etwa aus den USA und Australien vorliegen, sind zudem nicht systematisch erhoben – und reine Laborversuche. So werden beispielsweise für die Laborversuche häufig nicht die Virusvarianten (West-Nil-Virus und Insekten-spezifisches Virus) und Mückenarten verwendet, die sich in der Natur treffen, also lokal zusammen vorkommen. Zudem ist es vermutlich so, dass die Insekten-spezifischen Viren geografisch angepasst sind und etwa in Deutschland andere auftreten als in den USA.
Im Idealfall kann man aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppe um Sandra Junglen schließen, wie Vektor und Viren im Habitat zusammenwirken. Weil man diese Effekte wahrscheinlich aber nur sieht, wenn sie natürlicherweise in der Dreierkombination aus Viren und Vektor vorkommen, ist die Studie des Verbundprojektes bisher einzigartig.