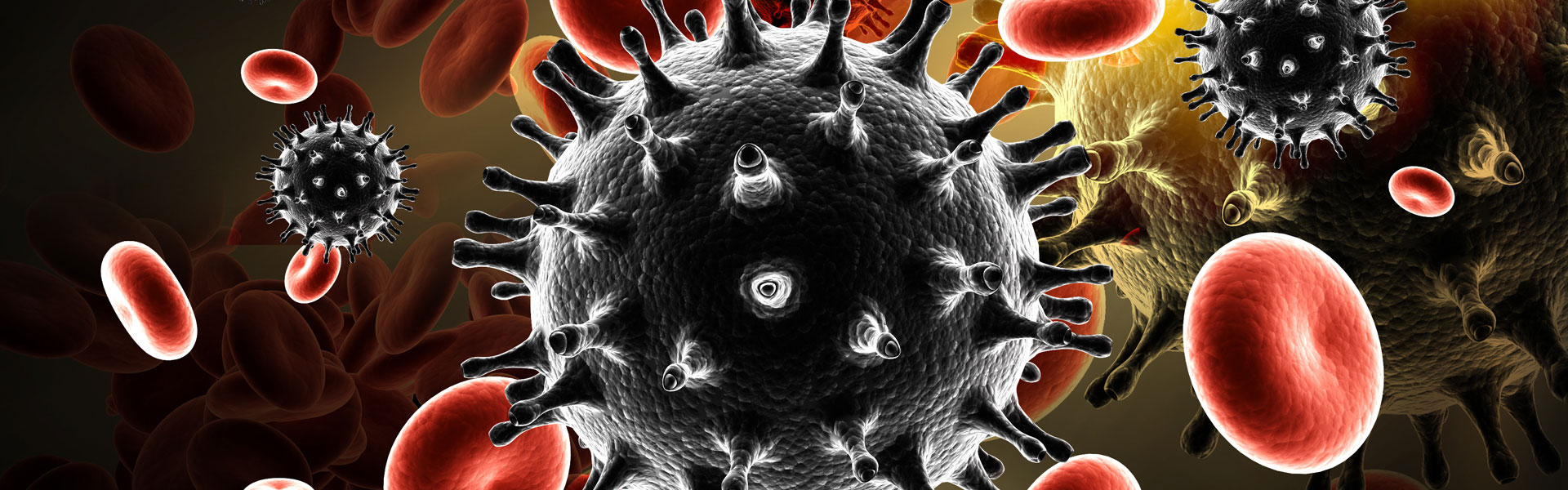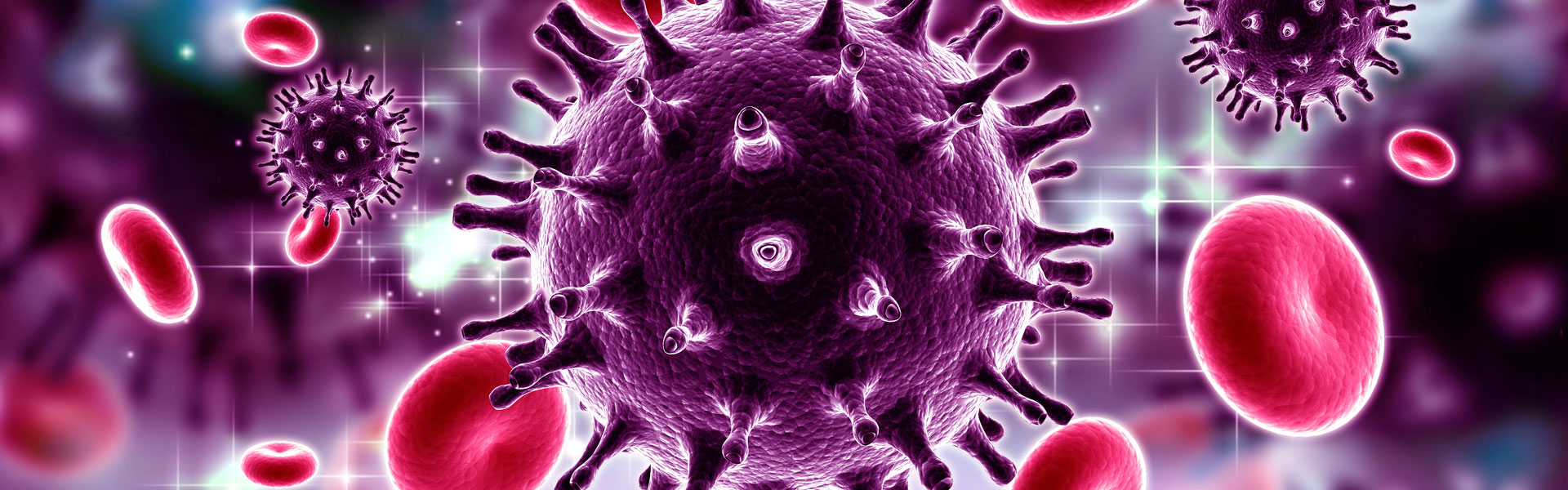Von Nagetieren und Menschen
Die Soldaten hatten einen Auftrag: den Kommunismus zurückdrängen, den Süden unterstützen. Doch in der Nähe des südkoreanischen Flusses Hantan, der zwei nördliche Provinzen durchfließt, treten Anfang der 1950er-Jahre plötzlich erste Fälle einer Erkrankung auf, die die US-Militärärzte zunächst nicht einordnen können, obwohl die Erkrankung in China und Skandinavien bereits in den 1920er-Jahren bekannt war. Ungewöhnlich starkes Fieber befällt die Soldaten, häufig folgt daraufhin Nierenversagen. Mehr als 3000 US-amerikanische Soldaten erkranken an der mysteriösen Infektion, zahlreiche sterben. Erst rund 25 Jahre später, 1978, gelingt dem Team um den südkoreanischen Virologen Ho Wang Lee, der zu dieser Zeit Direktor des Instituts für Viruskrankheiten der Korea University ist, die Isolierung des bislang unbekannten Virus. Er tauft es auf den Namen Hantaan-Virus (HTNV), abgeleitet von dem Fluss, an dem die ersten Fälle beschrieben wurden.
Die Isolation des Virus führt in der Folge zur Entdeckung weiterer verwandter Viren. Mittlerweile ist klar: Hantaviren kommen weltweit vor und stellen eine eigene Familie in der Ordnung der Bunyaviren dar. Sie sind behüllte Einzel-Strang-RNA-Viren mit einer Größe von 80 bis 120 nm. Je nach Virustyp können die humanpathogenen Arten verschiedene Erkrankungen auslösen. Dabei sind die Virustypen eng mit ihrem jeweiligen Reservoirwirt verbunden, doch eines haben sie gemeinsam: Ihr Reservoir ist ein Nagetier - jedes Hantavirus ist meist nur mit einer Nagetierart assoziiert und wird von dieser übertragen. Sind die Nager einmal infiziert, bleiben sie vermutlich lebenslang infektiös.
Zu den humanpathogenen Arten gehören neben dem HTNV das Puumala-Virus (PUUV), das Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV), das Seoul-Virus (SEOV), das Sin-Nombre-Virus (SNV), das Andes-Virus (ANDV) sowie in seltenen Fällen das Tulavirus (TULV). In Mitteleuropa und Deutschland kommen das PUUV, das DOBV und das Tulavirus (TULV) vor; kürzlich wurde in einer als Heimtier gehaltenen Ratte in Deutschland auch das SEOV nachgewiesen. Als Überträger der Erreger in Deutschland treten hauptsächlich die Rötelmaus im Süden und Westen für das PUUV sowie die Brandmaus im Osten und Norden für eine Variante des DOBV auf. Für die Übertragung sind die Ausscheidungen der Tiere, also Kot, Urin oder Speichel, von Bedeutung. Die so ausgeschiedenen Viren können mehrere Tage bis Wochen infektiös sein, selbst wenn die Ausscheidungen getrocknet sind. Ein direkter Kontakt zu den Nagern ist also nicht nötig, um sich zu infizieren. Eine Infektion ist bereits möglich, bei der Reinigung eines Stalls, einer Garage oder Unterstands, bei der Gartenarbeit oder beim Entfernen einer toten Maus, die von der Hauskatze mitgebracht wurde. Dabei geschieht die Infektion meist über Aerosole, das Einatmen von aufgewirbeltem Staub, der den Erreger enthält. Auch über eine Übertragung durch Bissverletzungen ist berichtet worden. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist bei den in Deutschland vorkommenden Virusarten allerdings bislang nicht bekannt.
Vermutlich ein großer Teil der Infektionen verläuft hierzulande symptomlos. Treten Beschwerden auf, dann nach einer Inkubationszeit von zwei bis vier Wochen zunächst mit plötzlich einsetzendem hohen Fieber, das drei bis vier Tage anhält. Hinzu kommen grippeähnliche Symptome wie Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen. Häufig treten zusätzlich Rachenrötung, Husten, Sehstörungen oder Lichtempfindlichkeit auf. Einige Tage später setzen Durchfall und Erbrechen ein. Weiterhin kann es zu akutem Blutdruckabfall und einem Mangel an Thrombozyten, einer so genannten Thrombozytopenie, kommen. Bezeichnet wird die Erkrankung als „Hämorrhagisches Fieber mit Renalem Syndrom“ (HFRS). Schließlich kann es zu Nierenbeeinträchtigungen bis hin zum Nierenversagen kommen. Die Letalität der Infektionen mit PUUV liegt unter einem Prozent, mit dem in Deutschland vorkommenden DOBV-Typ bei 0,3 bis 0,9 Prozent. Zwischen ein und zwei Prozent der deutschen Bevölkerung tragen Hantavirus-reaktive Antikörper in sich. DOBV-Varianten, die außerhalb Deutschlands endemisch sind, weisen eine Letalität von zehn bis 15 Prozent auf.
Ebenfalls aggressiv sind die Virusarten, die in Ostasien und auf dem amerikanischen Kontinent vorkommen. Infektionen mit HTNV weisen eine Letalität von bis zu fünf Prozent auf, die Letalität nach einer Infektion mit Hantaviren wie SNV und ANDV, die in Ländern wie den USA, Argentinien, Chile und Brasilien endemisch sind, liegt bei bis zu 40 Prozent. Im Verlauf der Erkrankung ist hier die Lunge betroffen, so dass es zu Lungenentzündungen und -ödemen kommen kann.
Seit rund 20 Jahren ist eine Infektion mit Hantaviren in Deutschland meldepflichtig. Der einigermaßen kurzen Zeit ist es auch geschuldet, dass aktuell noch keine Aussage möglich ist, inwiefern die Zahl der Erkrankungen in Deutschland insgesamt zunimmt. Dennoch gibt es Indizien, die darauf hindeuten, das Hantavirusinfektionen in Deutschland allgemein zunehmen. Belgien überwacht bereits seit Anfang der 1980er-Jahre das Infektionsgeschehen; seit der Jahrtausendwende nimmt hier die Zahl der Fälle zu.
Alle zwei bis drei Jahre wird ein starker Anstieg der durch das PUUV verursachten Infektionen nachgewiesen, aktuell auch im Jahr 2021. Verantwortlich hierfür sind die Mastjahre der Buchen. In diesen Jahren werfen die Bäume besonders viele Bucheckern ab, wovon sich die Rötelmäuse ernähren – und sich als Folge im darauffolgenden Winter und nächsten Frühjahr stark vermehren können. Der mögliche Einfluss des Klimawandels auf die Häufigkeit von Hantavirusinfektionen erfordert noch weitere One Health-basierte Forschungen, da klimatische Gegebenheiten in vielfältiger Weise die Umwelt, die Rötelmäuse, das Hantavirus und die Bevölkerung beeinflussen.
Welche Faktoren es genau sind, die zum Auftreten von „Hantavirusjahren“ beitragen, ob sich hierzu bestimmte Vorhersagemodelle entwickeln lassen können und welchen Einfluss der Klimawandel auf Hantaviren und deren Reservoire hat, sind nur einige der Fragen, mit denen sich innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten der Forschungsverbund RoBoPub beschäftigt. Darüber hinaus geht der Verbund unter anderem auch den Fragen nach, wie genau die Mechanismen einer Hantavirusevolution aussehen und inwiefern Fledermaus-assoziierte Hantaviren humanpathogen könnten. Neben den wissenschaftlichen Fragestellungen besteht eine sehr bedeutende Aufgabe des Verbundes, im Rahmen einer Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Institutionen des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Gefährdung der Bevölkerung zu kommunizieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu kommunizieren.
Denn neue Hantaviren wurden in den vergangenen Jahren in Reservoirtieren wie Fledermäusen, Maulwürfen und Spitzmäusen, die bislang nicht als Träger in Erscheinung traten, auch in Mitteleuropa entdeckt. Inwiefern diese humanpathogen sein könnten, ist noch nicht bekannt.
Quellen/weiterführende Informationen:
- https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/hantavirus-erkrankungen/ (LINK)
- https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00024165/Steckbrief_Hantavirus-Infektionen_2019-11-06-bf.pdf (LINK)
- https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00036440/FLI-FAQ-Hantavirus_2021-03-19-bf-K.pdf (LINK)
- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf?__blob=publicationFile (LINK)
- https://www.zoonosen.net/forschungsnetz/verbuende-nachwuchsgruppen/robopub (LINK)
- https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/hantavirus/index.htm (LINK)
- http://www.lwf.bayern.de/cms04/wissenstransfer/forstcastnet/238817/index.php (LINK)
- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/Hantavirus/Hantavirus.html (LINK)
- https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/Ausgaben/25_15.pdf?__blob=publicationFile (LINK)
- https://www.spektrum.de/news/warum-gibt-es-immer-mehr-hantainfektionen/1470773 (LINK)
- https://zoonosen.net/sites/default/files/redaktion/dateien/Erregersteckbrief_Hantaviren_Feb2021_PDF_neu.pdf (LINK)
- https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/hantaviren/ (LINK)