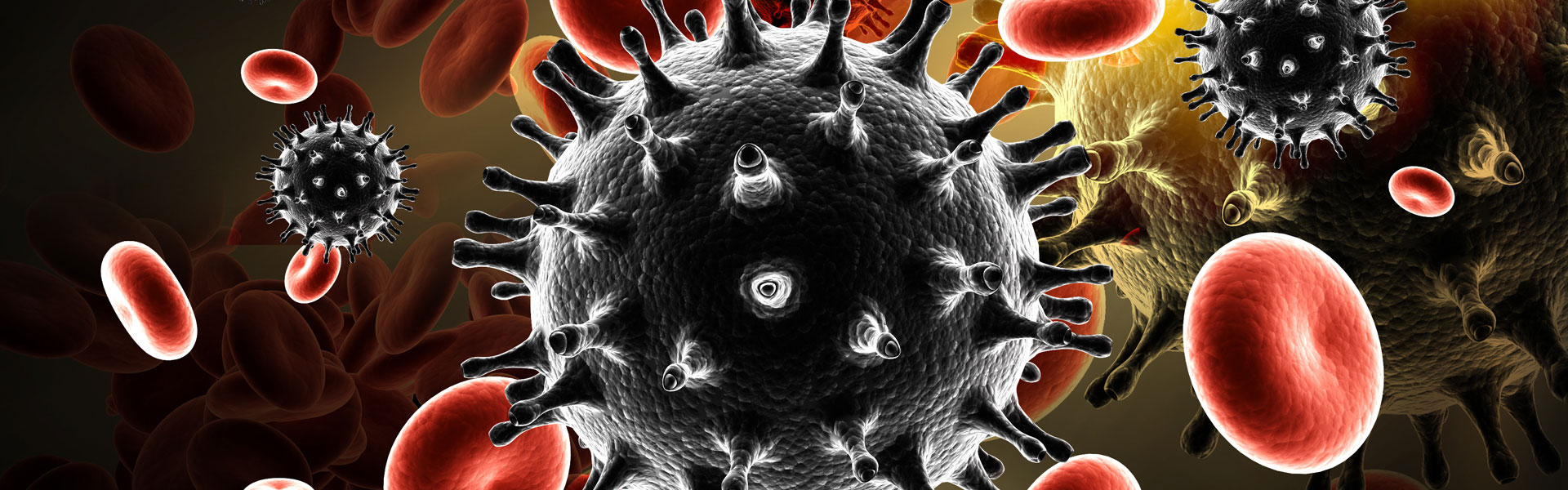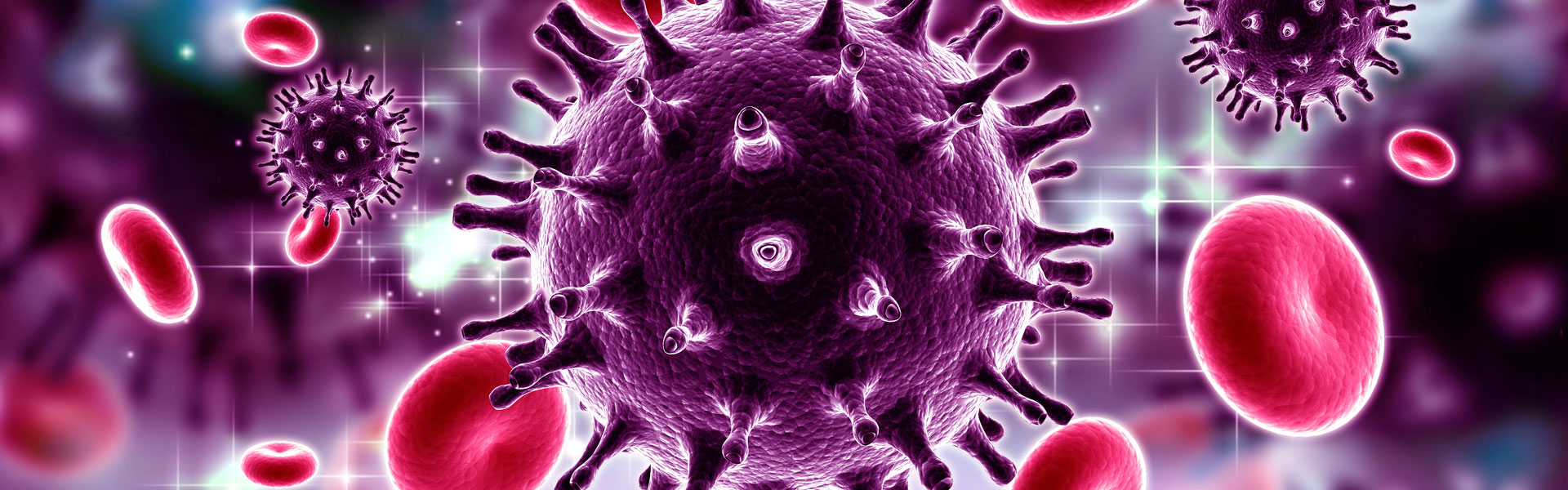7 Fragen an … Prof. Dr. Ard Nijhof
Sein Forschungsgebiet sind Zecken - und die mit ihr einhergehenden zoonotischen Infektionskrankheiten: Prof. Dr. Ard Nijhof ist am Institut für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin der Freien Universität Berlin tätig. Innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten koordiniert er die Nachwuchsgruppe Tick-Borne Zoonoses (TBZ).
Seit wann gehört die Zecke zu Ihren Forschungsschwerpunkten?
Ich hatte das Glück, einen Teil meines veterinärmedizinischen Studiums in Südafrika zu absolvieren, wo ich ein Forschungspraktikum mit Schwerpunkt auf durch Zecken übertragene Krankheiten von Wildtieren durchführen durfte. Während meines Aufenthalts erhielten wir Proben von Spitzmaulnashörnern, die an Babesiose, einer Malaria-ähnlichen, von Zecken übertragenen Krankheit, gestorben waren. Wir konnten den Erreger dieser Krankheit zum ersten Mal auf molekularer Ebene charakterisieren und seitdem bin ich in diesem Forschungsgebiet geblieben.
Weshalb ist die Zecke ein Thema für einen Tropenveterinärmediziner?
Während Stechmücken die relevantesten Krankheitsüberträger für Menschen sind, denken Sie nur an Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber, spielen Zecken eine ähnliche Rolle in der Veterinärmedizin, da sie eine breite Palette an Krankheitserregern übertragen können. Die meisten dieser Erreger zirkulieren seit Jahrtausenden zwischen Zecken und Wildtieren, wo sie relativ wenig Schaden anrichten, können aber bei domestizierten Tieren, die diese lange Koevolution nicht teilen, schwere Krankheiten verursachen. Abgesehen davon können Zecken durch das Blutsaugen auch eine direkte schädliche Wirkung auf Tiere haben, insbesondere in tropischen Gebieten, in denen Zecken in großer Zahl vorhanden sind.
Sind Zecken bislang noch zu wenig untersuchte Parasiten?
Ja, viele Fragen über die Biologie der Zecken sind zum Beispiel noch unbeantwortet. Wir haben zum Beispiel gerade erst angefangen zu enträtseln, wie Zecken Krankheitserreger übertragen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Krankheitserreger auch Zeckenproteine für ihr Überleben und ihre Übertragung nutzen. Solche Forschungen sind relevant, da sie zur Entwicklung neuartiger Bekämpfungsstrategien führen können, z. B. Impfstoffe basierend auf Zeckenproteinen, die mit der Übertragung von Krankheitserregern in Verbindung stehen, und damit diesen Prozess blockieren könnten.
Inwiefern kann in Ihrer Forschung die CRISPR/Cas9-Technik helfen?
Aktuelle Methoden zur Untersuchung der Zeckenproteinfunktion beruhen hauptsächlich auf der spezifischen Stilllegung der Zeckengenexpression durch RNA-Interferenz (RNAi). Dabei werden Zecken mit doppelsträngigen RNA (dsRNA) injiziert, die eine zum Zielgen komplementäre Sequenz hat. Die dsRNA breitet sich im Zeckenkörper aus und gelangt in die Zellen, wo die Expression des Zielgens stillgelegt wird. Anschließend werden die Zecken gefüttert und es kann der resultierende Phänotyp untersucht werden. Obwohl RNAi relativ schnell und einfach in adulten Zecken zu etablieren ist, ist der RNAi-Effekt vorübergehend, selten 100% effizient und zudem stellt die dsRNA-Injektion in (kleineren) juvenilen Lebensstadien eine Herausforderung dar. Viele dieser Nachteile könnten durch die CRISPR/Cas9-Technik überwunden werden, da die Proteinexpression in Knock-out-Ansätzen vollständig blockiert werden kann. Sie ist auch vielversprechend für die Einführung von Genen in das Zeckengenom, was Studien zur Funktion von Zeckengenen ermöglicht, die mit RNAi-Ansätzen nicht möglich wären.
Sie forschen mit der in Europa weit verbreiteten Zeckenart Ixodes ricinus. Wie können die Tiere im Labor gefüttert werden?
Zecken benötigen Blut für ihre Entwicklung und die herkömmliche Methode, sie im Labor zu halten, ist eine Fütterung an Versuchstieren. Da Ixodes ricinus (I. ricinus) ein sehr breites Wirtsspektrum hat, kann sie an einer Vielzahl von Tieren gefüttert werden. Mäuse, Rennmäuse und Kaninchen werden für diese Zeckenart am häufigsten verwendet.
Im Rahmen unserer Nachwuchsgruppe haben wir ein künstliches Zeckenfütterungssystem für I. ricinus als Alternative für die Fütterung von Zecken an Tieren adaptiert. Hier werden Zecken in ein Glasröhrchen gesetzt, was auf einer Seite mit einer Silikonmembran abgeschlossen ist. Diese Seite wird anschließend in auf 37°C erwärmtes Blut getaucht. Nach dem Durchstechen der Membran mit ihren Mundwerkzeugen können Zecken das Blut aufnehmen. Wir konnten mit dieser Methode alle Lebensstadien von I. ricinus erfolgreich füttern und untersuchen derzeit unter anderem den Effekt der künstlichen Fütterung auf die Aufrechterhaltung von I. ricinus über mehrere Generationen.
Welches Ziel verfolgt die Nachwuchsgruppe TBZ?
Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung neuartiger Werkzeuge zur Untersuchung der Biologie von I. ricinus. Dazu gehört die Entwicklung und Evaluierung künstlicher Fütterungsmethoden, nicht nur für die Aufrechterhaltung von Laborzuchten, sondern auch für andere Anwendungen, wie z. B. in vitro-Infektionsmodelle, bei denen kultivierte Krankheitserreger der Blutmahlzeit zugesetzt werden, um Zecken künstlich zu infizieren. Dies wird es uns ermöglichen, Zecken-Pathogen-Interaktionen zu studieren und manipulieren, während gleichzeitig der Bedarf an Versuchstieren reduziert wird.
Das zweite Ziel ist die Etablierung und Optimierung von CRISPR/Cas9 in Zecken und dessen Verwendung für die Untersuchung von Zeckenproteinen.
Welches Projekt oder welche Studie steht bei TBZ aktuell an?
Anfang dieses Jahres haben wir I. ricinus-Larven mit den Erregern der Lyme-Borreliose infiziert, indem wir Blutmahlzeiten mit verschiedenen Borrelia-Spezies versetzt haben. Die Zecken haben sich nun zu Nymphen gehäutet und wir werden untersuchen ob, wann und wie sie diese Bakterien in einem in vitro Modell übertragen.
Das Interview führte Christoph Kohlhöfer