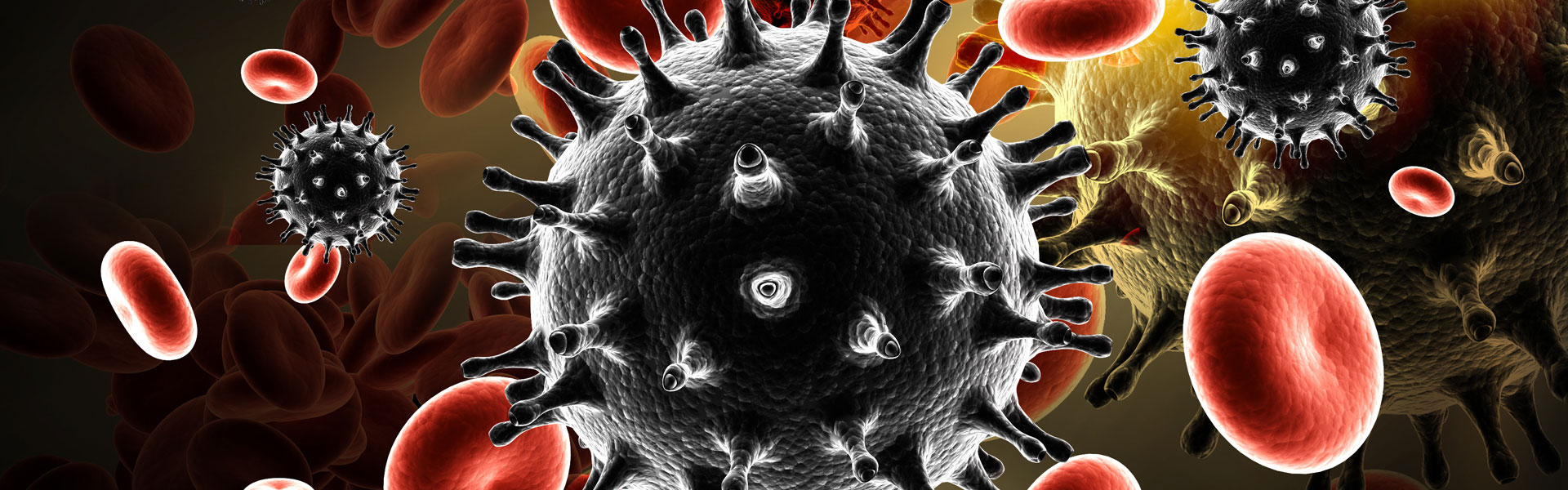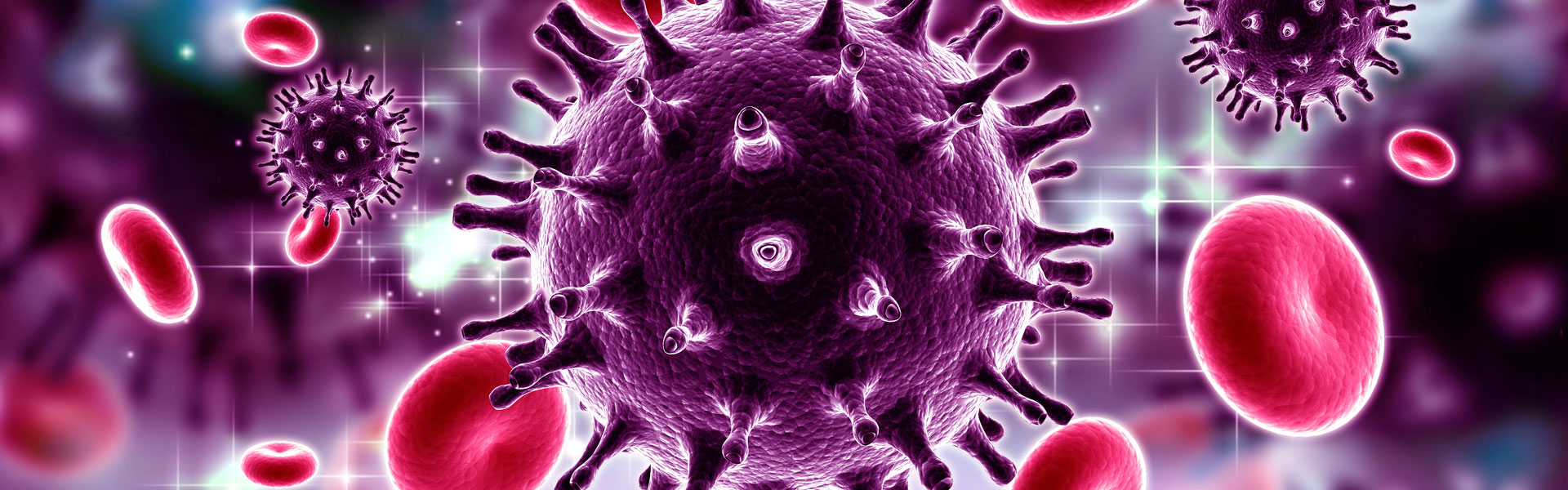Insel der Tierseuchen
Dort, wo Prof. Dr. Rainer Ulrich und seine Arbeitsgruppe an Hantaviren forschen, ist es landschaftlich ziemlich hübsch. Unter normalen Umständen wäre die Insel sicherlich touristisch erschlossen. Doch Urlauberhotels gib es hier keine. Der mögliche Platz hierfür ist bereits mit einem anderen Gebäude-Komplex besetzt: dem Friedrich-Loeffler-Institut. Und was in dessen Räumen lagert, möchten die meisten Menschen nicht unbedingt in ihrer Nachbarschaft haben. An rund 80 verschiedenen Erregern von Tierseuchen wird hier geforscht, weshalb die Insel von einigen Medien auch leicht übertrieben als „eine der gefährlichsten Inseln der Welt“ bezeichnet wird.
„Der Riems“, wie die Insel von Ortsansässigen genannt wird, liegt im Südwesten des Greifswalder Boddens, südlich von Rügen. Gerade einmal 1,3 Kilometer lang und 300 Meter breit ist die Insel. Mit dem Friedrich-Loeffler-Institut beherbergt sie die älteste virologische Forschungseinrichtung der Welt – und eine der modernsten Forschungsstätten Europas. Der Schwerpunkt des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit sind Tierseuchen. Einige der Erreger haben den Übergang auf den Menschen bereits geschafft, andere bislang noch nicht. Da jedoch rund 70 Prozent aller Infektionserreger beim Menschen ursprünglich aus dem Tierreich stammen, dient die Erforschung von Tierseuchenerregern potenziell immer auch der Gesundheit des Menschen.
1910 lässt Friedrich Loeffler die ersten Labor- und Stallgebäude auf dem Riems errichten. Am 13. Mai 1911 verkündet ein Schild: „Das Landen auf der Insel Riems sowie das unbefugte Betreten derselben ist verboten.“ Zu diesem Zeitpunkt ist Riems nur per Boot zu erreichen. Eine Sicherheitsvorkehrung, die nicht ganz unbegründet ist.
Als Schüler von Robert Koch hatte sich Friedrich Loeffler mit der Entdeckung der Erreger von Rotz, Diphterie und Erysipel einen Namen gemacht. Als Professor für Hygiene und Geschichte der Medizin an der Königlichen Universität zu Greifswald beauftragt ihn 1897 die preußische Regierung, ein Mittel gegen eine mysteriöse Krankheit zu finden, die immer wieder Tausende Schweine und Rinder verenden lässt. In der Nähe der heutigen Charité richtet sich Loeffler in zwei Berliner S-Bahn-Bögen ein. Und schon 1898 kommt er dem Erreger der Maul- und Klauenseuche auf die Spur. Als Bakteriologe geht er zunächst von einem Bakterium aus, schnell stellt er jedoch fest, dass „allerkleinste Organismen“, kleiner als Bakterien, verantwortlich sein müssen. Damit begründet er die Virologie.
Doch das Areal in Berlin reicht für seine Forschungen nicht aus. Also geht er zurück nach Greifswald. Am Rande der Stadt setzt er seine Versuche auf einem alten Bauernhof-Gelände fort. Der Erreger allerdings ist leicht übertragbar und entkommt immer wieder, so dass sich die Tiere der benachbarten Höfe infizieren. Schließlich werden die Forschungen Loefflers von oberster Stelle, dem Minister der Geistlichen-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, verboten. Riems, die kleine Insel in der Nähe von Greifswald, erscheint Loeffler eine gute Lösung, um seine Forschungen fortzuführen, ohne Nachbarbetriebe zu gefährden.
Heute ist die Insel, dank eines 1971 errichteten Damms, auch auf dem Landweg zu erreichen. Die Sicherheitsvorkehrungen gegen die potenzielle Seuchengefahr sind allerdings weiterhin streng. Hohe Zäune, Stacheldraht, Überwachungskameras, bewachter Eingang umgeben das Gelände, das nur mit einer Genehmigung betreten werden darf. Zusätzlich sind die Hochsicherheitslabore in dem Gebäudekomplex von dicken Metalltüren, Materialschleusen und Edelstahlduschen umgeben. Wer eintritt, trägt einen Ganzkörperanzug mit eigener Luftzufuhr und Funkkontakt. Die Zu- und Abluft der Labore wird doppelt gefiltert, die Abwässer in Sammeltanks sterilisiert, bevor sie zur eigenen Kläranlage weitergeleitet werden, die alle Abfallprodukte dekontaminiert und speziell entsorgt. Das alles unterbindet, dass Erreger in die Außenwelt gelangen oder Unbefugte Zugang zu Pathogenen bekommen.
„Wenn ich zu Privatleuten in einen Raum komme, um dort Mäuse zu fangen oder tote Mäuse einzusammeln, ist das eine gefährlichere Situation, als hier auf der Insel zu forschen. Die Vorkehrungen, die hier getroffen werden, sind ausgezeichnet. Wir wissen, womit wir es zu tun haben und gehen dementsprechend geschützt vor“, sagt Prof. Dr. Rainer Ulrich.
Unter Hochsicherheitsbedingungen können auf der Insel die Erreger – inklusive die Erreger der höchsten Sicherheitsstufe – auch an großen Tieren erforscht werden. Weltweit ist das nur an drei Orten möglich: in Winnipeg in Kanada, Geelong in Australien, und eben auf dem Riems. Das ermöglicht, Tierseuchenerreger auch in ihrem Originalwirt zu untersuchen und nicht nur in Modelltieren, wie Mäusen. Der Erkenntnisgewinn ist dadurch ungleich höher.
Aber natürlich werden hier auch kleine Tiere wie Mücken, Zecken und Hühner untersucht. Und Nagetiere mit ihren verschiedenen Hantaviren.