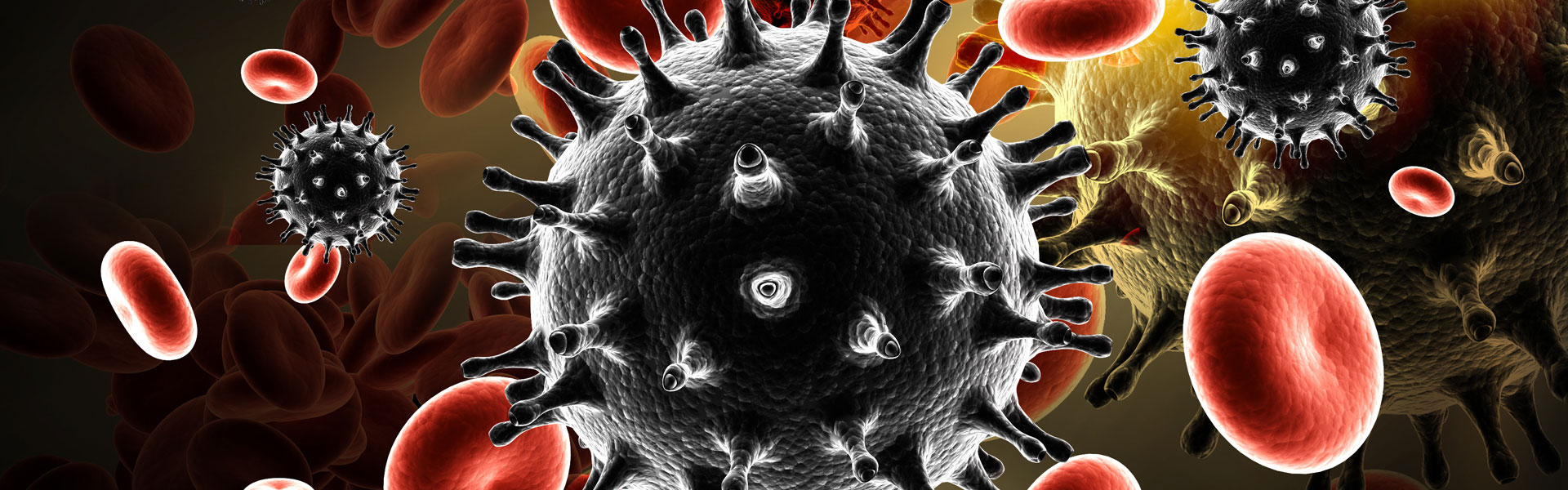„Die Evolution von Hantaviren hängt eng mit der Evolution von Nagetieren zusammen“
Am Friedrich-Loeffler-Institut auf Riems leitet Prof. Dr. Rainer G. Ulrich das Nationale Referenzlabor für Hantaviren (bei Tieren) im Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger. Darüber hinaus koordiniert er innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten den Verbund RoBoPub. Hantaviren gehören seit rund 20 Jahren zu seinem Spezialgebiet.
Weshalb sind Hantaviren Ihr Forschungsgegenstand?
Nach der Wende gab es Forschungsinitiativen, bei denen Gruppen aus der ehemaligen DDR und der BRD gemeinsame Projekte angingen. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte ich mich an der Charité mit virusähnlichen Partikeln. Wir kooperierten mit einer Gruppe aus Heidelberg, die sich damals schon mit Hantaviren auseinandersetzte - sie waren praktisch die Pioniere der Hantavirusforschung in Deutschland. Innerhalb unseres gemeinsamen Projektes haben wir versucht, virusähnliche Partikel herzustellen, die man für diagnostische Verfahren oder Impfungen nutzen kann. Das war Mitte der 1990er-Jahre der Anfang meiner Beschäftigung mit Hantaviren. 2004 wechselte ich zum Friedrich-Loeffler-Institut nach Wusterhausen. Nebenbei konnte ich dort, sozusagen als Einzelkämpfer, die Hantavirusforschung weiterführen. Mein eigentliches Thema waren dort Parasiten bei Füchsen. 2006 kam ich dann nach Riems. Als Laborleiter baute ich eine Gruppe auf, die an Hantaviren forscht.
Virologie war also bereits zu DDR-Zeiten ihr Fachgebiet?
Von der Ausbildung her bin ich Genetiker. Mein Studium absolvierte ich in Halle und sehe mich als Schüler von Rudolf Hagemann, der in der DDR ein berühmter Genetiker war, der sich mit Pflanzengenetik beschäftigte. Das Studium war sehr breit aufgestellt. Pflanzengenetik und Mikrobengenetik waren die Schwerpunkte. Von dort aus nahm ich Kontakt auf zum Institut für Virologie der Charité. Meine Diplomarbeit schrieb ich dann am Zentralinstitut für Molekularbiologie der damaligen Akademie der Wissenschaften über ein Virus, von dem man vermutete, dass es Tumoren beim Menschen verursachen könnte. 1990 wurde ich dann Mitarbeiter am Institut für Medizinische Virologie der Charité.
Was ist denn das Besondere an Hantaviren?
Das Reizvolle ist, dass es bisher keine reverse Genetik gibt. Klassische Genetik bedeutet: Ich habe einen Mutanten-Phänotyp, der sich vom Wildtyp-Phänotyp unterscheidet und dem ich eine bestimmte genetische Veränderung im Vergleich zum Wildtyp zuordnen kann. Bei der reversen Genetik gehe ich genau umgekehrt vor: Ich kenne die genetische Information, beispielsweise eines Virus, und spekuliere darüber, dass eine bestimmte Region des Genoms eine Rolle für den Phänotyp spielt. Ich verändere die genetische Information und überprüfe dann, ob der hypothetische Phänotyp hervorgerufen wird. Für Hantaviren existiert ein solches System nicht. Ich kann das Virus nicht nehmen und verändern und erhalte dann wieder infektiöse Viruspartikel. Der Schritt von einer genetischen Manipulation zu einem Viruspartikel gelingt bisher nicht. In der modernen Virologie ist das praktisch eine Standardmethode, die für alle Virusgruppen mehr oder weniger etabliert ist. Die große Frage ist, warum das hier (bisher) nicht funktioniert.
Woran liegt denn die unterschiedliche Letalität der verschiedenen Hantavirus-Spezies?
Das ist eine ungeklärte Frage. Es gibt bislang keine guten Tiermodelle, mit denen man die Ursachen der unterschiedlichen Pathogenität untersuchen könnte.
Könnte es sein, dass die mitteleuropäischen Spezies dermaßen mutieren, dass sie eine höhere Letalität beim Menschen zur Folge haben?
Man kann die Evolution der Hantaviren nur verstehen, wenn man versteht, dass sie an die Nagetiere adaptiert sind. Die Adaptation an die Nagetiere ist sozusagen der Treiber der Veränderung der Viren. Jedes Hantavirus hat einen spezifischen Nagetierwirt. Man könnte postulieren, dass die Evolution der Hantaviren dazu führte, dass sie immer weniger pathogen für die Nagetiere wurde. Erfolgreich ist ein Virus, wenn es in den Reservoirpopulationen weitergegeben wird. Die Letalität beim Menschen ist ein Sekundäreffekt. Die eigentliche Baustelle ist: Hantavirus plus Nagetier.
Das für den Menschen äußerst gefährliche Sin-Nombre-Virus tötet seinen Nagetierwirt nicht…
Genauso ist es. Das Sin-Nombre-Virus (SNV) und das Puumala-Virus (PUUV) sind näher miteinander verwandt als das SNV mit dem Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV). Auch die antigenische Verwandtschaft zwischen SNV und PUUV ist größer. Dennoch sind das SNV und das DOBV deutlich pathogener als das PUUV.
Der Krankheitsverlauf in Deutschland nach einer Infektion mit Hantaviren ist eher mild. Werden Infektionen mit Hantaviren deshalb in der Öffentlichkeit unterschätzt?
Dadurch, dass wir mit Menschen aus Forstinstitutionen und Ökologen, die sich mit Kleinsäugern beschäftigen, zu tun haben, ist unsere Erfahrung eine andere. Die Sensibilisierung bestimmter Personenkreise hängt oft damit zusammen, ob man im Bekanntenkreis Fälle einer Infektion geschildert bekommen hat. Man sagt zwar immer, dass eine Hantavirusinfektion in Deutschland relativ mild verlaufe, die Rekonvaleszenzzeit kann jedoch ziemlich lange sein. Es gibt Fälle von mehr als sechsmonatiger Krankschreibung. Und natürlich gibt es auch schwerwiegende Verläufe und Todesfälle. Seit 2001 haben wir eine Meldepflicht in Deutschland für Hantaviruserkrankungen und das Robert Koch-Institut hat seitdem mehr als 14.000 registrierte Fälle gezählt.
Wenn sich die Nagetiere, die das Sin-Nombre-Virus in sich tragen können, bei uns heimisch würden, würde sich dann auch das SNV in unseren heimischen Mäusen verbreiten?
Im Prinzip wissen wir das nicht. Wir haben beispielsweise eine Studie durchgeführt, bei der wir gefragt haben: Wie oft finden wir das PUUV, was normalerweise in der Rötelmaus vorkommt, in anderen Nagetieren, die im gleichen Gebiet leben. Hier fanden wir nur eine einzige Übertragung auf eine Erdmaus. Solche Übertragungen finden demnach sehr, sehr selten statt. Der Reservoirwirt des SNV kommt aber nicht in Europa vor, die Gefahr einer Übertragung auf heimische Nagetiere ist also nicht vorhanden. Dennoch gibt es Beispiele, dass sich umgesiedelte invasive Arten behaupten können, wie etwa in Europa die Bisamratte oder das Grauhörnchen, die ursprünglich aus Nordamerika kommen.
Wenden sich denn Menschen an Sie, bei denen Hantavirusverdacht besteht?
Das kommt immer wieder vor. Beispielsweise wurde ich bei einer Hantavirusinfektion von einer Katzenbesitzerin kontaktiert. Ein relativ bekanntes Phänomen ist, dass Katzen zum Teil ihre Beute, die Maus, leben lassen. Wenn sie diese nach Hause mitbringen und dort mit ihrer Beute spielen, kann es durchaus zur Exposition mit dem Erreger kommen. Ausscheidungen von Mäusen in geschlossenen Räumen machen eine Infektion wahrscheinlicher. Der wichtige Punkt ist: Man muss wissen, mit welcher Maus man es gerade zu tun hat. Bei einer Hausmaus spielen Hantaviren keine Rolle.
Hausmäuse sind nicht Träger von Hantaviren?
Wir kennen kein Hantavirus bei Hausmäusen. Weltweit wurde bislang bei keiner Hausmaus ein spezifisches Hantavirus gefunden.
Das Puumala-Virus kommt nur in der Rötelmaus vor…
Ja, die Rötelmaus ist in ganz Deutschland verbreitet, das PUUV ist allerdings nur in bestimmten Regionen in Deutschland vorhanden. Wir gehen davon aus, dass hierfür die nacheiszeitliche Besiedlung ein Faktor ist. Beim PUUV vermuten wir, dass das Virus mit der Rötelmaus aus einem eiszeitlichen Refugium, das südwestlich von Deutschland gelegen war, eingeschleppt worden ist. Die Ausbreitung des Virus ist sicherlich nicht abgeschlossen, wir kennen aber die gegenwärtige Verbreitungsgrenze in Deutschland.
Kann man sagen, von wo Hantaviren denn ursprünglich stammen?
Möglicherweise stammen Hantaviren aus dem asiatischen Raum. Dort war vermutlich ein Hotspot der Nagetierevolution. Wenn man sich mit der Evolution der Nagetiere auseinandersetzt, kommt man an dieser Region nicht vorbei. Würde man davon ausgehen, dass alle Nagetier-Hantaviren auf ein einziges Urvirus zurückgehen, würde man in dieser Region forschen. Aber inzwischen wissen wir auch von Hantavirus-Verwandten aus Fischen….
Welche Sicherheitsstufe haben Hantaviren denn bei uns?
Wir haben Hantaviren, die in Risikogruppe 2 eingruppiert sind, wie das PUUV und das Tula-Virus (TULV), sowie Hantaviren, die in Risikogruppe 3 eingestuft sind.
Das Interview führte Philipp Kohlhöfer.