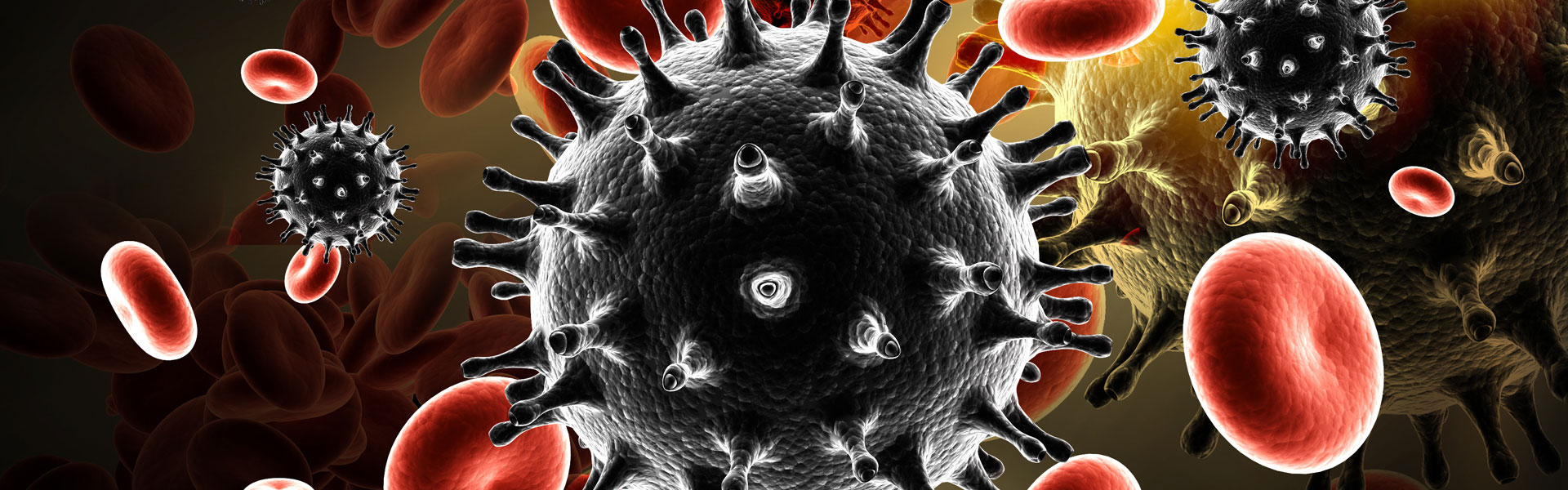Invasion am Boden
Klimatische Veränderungen können den Ausbruch von zoonotischen Infektionskrankheiten begünstigen. Ein Profiteur des Klimawandels ist die Zecke bzw. bestimmte Zeckenarten. Und als Vektoren können Zecken für den Menschen durchaus gefährliche Krankheiten übertragen. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis und die Lyme-Borreliose sind die hierzulande bekanntesten und verbreitetsten. Ob sich zukünftig Erkrankungen wie Tularämie oder das Krim-Kongo-Fieber ausbreiten können, ist fraglich – ihre Überträger allerdings sind bereits da.
Europaweit sind Zecken die häufigsten Vektoren von zoonotischen Krankheiten, weltweit rangieren sie hinter den Mücken auf Platz zwei. Die Ixodes ricinus (I. ricinus), der Gemeine Holzbock, ist die häufigste europäische Zeckenart. Sie kann FSME und die Lyme-Borreliose übertragen. Besonders das Verbreitungsgebiet von FSME hat sich in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich Richtung Norddeutschland ausgeweitet. Im vergangenen Jahr gab es mit 708 die bislang meisten gemeldeten Fälle an FSME-Infektionen. Als Gründe hierfür macht Prof. Dr. Gerhard Dobler, der innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten die Gruppe TBENAGER (Tick-Borne ENcephAlitis in GERmany) koordiniert, mehrere Komponenten aus: eine hohe Zeckenpopulation im Frühjahr, ein hohes Vorkommen des FSME-Virus in den Zecken und eine erhöhte Anzahl an Menschen, die durch den Lockdown im Frühjahr 2020 vermehrt in der Natur unterwegs waren.
Darüber hinaus breitet sich I. ricinus zunehmend in höheren Lagen und in Waldgebieten aus – eine direkte Folge von steigenden Temperaturen, die das Verhalten von Zecken beeinflussen. Denn entscheidend für die Zeckenaktivität ist die Bodentemperatur. Ab ungefähr 8°C ist der Gemeine Holzbock aktiv. Ist der Winter mild, begünstigt das die Dauer seiner Aktivität. Doch bevorzugt er auch Plätze mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie etwa Gestrüpp oder Unterholz.
Seit den 70er-Jahren verbreitet sich die ursprünglich aus Südeuropa stammende Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) in Deutschland. „Wir sehen, dass sich die Auwaldzecke vor allem in den letzten Jahren dramatisch ausgebreitet hat – vor allem in Ost- und Norddeutschland. Mehrere zehn Kilometer pro Jahr beträgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit“, sagt Gerhard Dobler. Unter anderem ist die Auwaldzecke Überträger des Q-Fiebers, Fleckfiebers und der sogenannten Hundemalaria (Babesiose des Hundes), die die roten Blutkörperchen zerstört und dadurch schnell zum Tod des Tieres führen kann.
Neuere invasive Arten, die in den vergangenen Jahren vermehrt in Deutschland nachgewiesen wurden, sind Hyalomma marginatum (H. marginatum), Hyalomma rufipes (H. rufipes) und Rhipicephalus sanguineus, die Braune Hundezecke. Das Besondere an ihnen: Im Gegensatz zu ihren europäischen Verwandten ist Feuchtigkeit für sie nicht von Vorteil, im Gegenteil, vermehrte Trockenheit kommt ihnen entgegen.
Die Braune Hundezecke stammt ursprünglich aus Nordafrika, ist mittlerweile in ganz Südeuropa heimisch und breitet sich weiter Richtung Norden aus. Auch ohne einen Wirt kann sie bis zu einem Jahr überleben, was ihr gerade in einer kühleren Umgebung zugute kommt – denn dann verfällt sie in eine Kältestarre, bis die Temperaturen für sie wieder angenehmer sind. Als Vektor spielt sie eine Rolle bei Erkrankungen von Hunden. So kann sie unter anderem die Erreger der Ehrlichiose und der Hepatozoonose übertragen. Beide befallen die weißen Blutkörperchen und sorgen dadurch für eine ganze Reihe von akuten und chronischen Symptomen.
Die tropischen Zeckenarten H. marginatum und H. rufipes, die eigentlich in den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas heimisch sind, lassen sich mittlerweile sogar in Norddeutschland finden. Bereits vor drei Jahren wurden erste Exemplare der Hyalomma-Zecken in Deutschland nachgewiesen. „Die damals gefundenen Exemplare sind per Zugvögel eingereist. Ein Jahr später jedoch haben wir fünf Exemplare auf Pferdehöfen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ausmachen können, die dort überwintert hatten“, sagt Gerhard Dobler.
Und die Hyalomma-Zecken unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von ihren bislang bei uns heimischen Verwandten. Allein ihr Erscheinungsbild ist beeindruckend: Sie ist zwei- bis dreimal größer als der Gemeine Holzbock, und ihre Beine sind farblich markant geringelt. Während die uns bekannte Zecke sich gerade einmal ein bis zwei Meter während ihres gesamten Lebens von selbst fortbewegt, machen Hyalomma-Zecken mehrere Meter aktiv Jagd auf ihre Blutmahlzeit. Darüber hinaus ist Sie Überträger des Krim-Kongo-Virus, das beim Menschen eine gefährliche Erkrankung verursachen kann.
Auf Ponza, einer italienischen Insel im Mittelmeer, wurden auf Zugvögeln bereits Hyalomma-Zecken entdeckt, die mit dem Krim-Kongo-Virus infiziert waren. „Die Überlegung, ob das Krim-Kongo-Fieber bei uns eingeschleppt werden kann, ist nicht rein theoretischer Natur, sondern hat durchaus praktische Bedeutung“, sagt Prof. Dr. Dobler.
Inwiefern sich die Zecke in Deutschland etablieren kann, wird sich noch herausstellen. Man könne davon ausgehen, dass bereits vor 30 oder 40 Jahren Zugvögel die Hyalomma-Zecken im Gepäck hatten, so Gerhard Dobler. Doch habe sie sich aufgrund der klimatischen Bedingungen hier nicht weiterentwickeln können. Das habe sich in den trockenen Sommern der vergangenen Jahre verändert. Aus epidemiologischer Sicht sei jedoch die Ausbreitung der Zeckenarten I. ricinus und Dermacentor reticulatus aktuell von größerer Bedeutung.
Und selbst wenn sich Zecken der Gattung Hyalomma hierzulande etablieren, bedeutet dies nicht automatisch, dass sie auch das Krim-Kongo-Virus verbreitet. Einen anderen humanpathogenen Erreger trägt rund die Hälfte der gefundenen Hyalomma-Zecken jedoch bereits in sich: Rickettsia aeschlimannii, die das Zecken-Fleckfieber auslösen. Schon 2019 wurde die schmerzhafte Erkrankung bei einem Pferdezüchter mutmaßlich durch den Stich einer Hyalomma-Zecke verursacht.