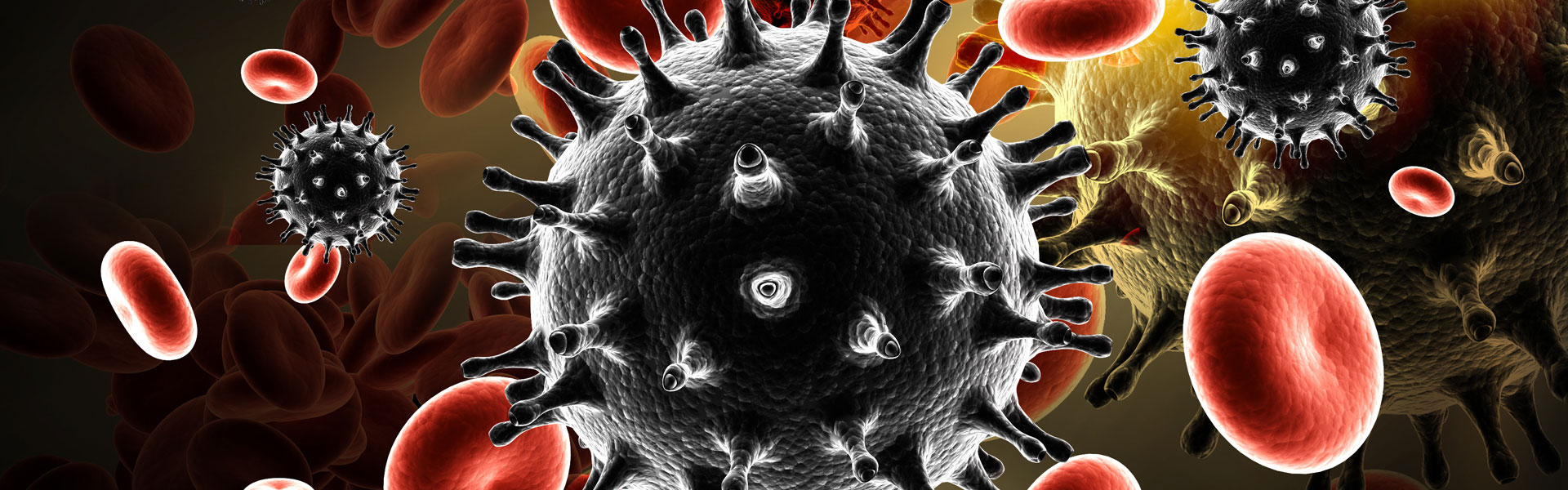„Artensterben begünstigt die Ausbreitung von Viren“
Am Institut für Virologie an der Charité in Berlin forscht und lehrt PD Dr. rer. nat. Sandra Junglen. Mit der Nachwuchsgruppe ARBOSPREAD ist sie Teil des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten. Ihre Spezialität sind Moskitos. Dabei vereint sie in ihrer Forschung Ökologie, klassische Biologie und Molekularbiologie, um Aussagen über das Verhalten von Arboviren treffen zu können.
Wie lange beschäftigen Sie sich bereits mit Arboviren und weshalb?
Seit dem Beginn meiner Doktorarbeit 2004 stehen Arboviren bei mir im Mittelpunkt. Vorher arbeitete ich an der Elfenbeinküste mit Schimpansen und erstellte Verhaltensstudien. Die Arbeit in den Tropen hat mir sehr zugesagt, das alleinige Erstellen von Verhaltensstudien allerdings eher weniger. Forschung in den Tropen, Laborarbeit und Molekularbiologie wollte ich für meine zukünftige Tätigkeit miteinander verbinden. Außerdem wollte ich weiterhin in dem Kontext „Naturschutz“ forschen. Ich bin dann auf Arboviren, also von Moskitos übertragene Erreger, gestoßen. Thematisch ist das ein großes Gebiet: Abholzung von Regenwald, Veränderung von Ökosystemen, die Ausbreitung von neuen Infektionskrankheiten – das alles sind Elemente der Forschung an Arboviren.
Hat Ihr Forschungsfeld nach der Zika-Epidemie 2015/2016 eine neue öffentliche Wahrnehmung erfahren?
Das Thema dringt eigentlich gerade jetzt in Zusammenhang mit SARS-CoV2 ins öffentliche Bewusstsein ein. Viele Jahre lang wurde zwar Interesse an meiner Forschung bekundet, aber sie blieb außen vor, so nach dem Motto „Das ist ja ganz nett mit den Gradientenstudien im Urwald“. Die meisten Wissenschaftler arbeiten dann eben doch eher molekularbiologisch an einem speziellen Virus. Naturveränderungen, die Rolle von Biodiversität und die Frage, wie überhaupt Pandemien entstehen, werden jetzt in den Medien breit diskutiert, so dass mein Themengebiet in den Fokus der Wahrnehmung rückt.
Sie suchen neuartige, bisher unbekannte Viren…
Das war ursprünglich nicht der Plan. Es ist eher erstaunlich, dass wir viele neue Viren gefunden haben. Die Idee war, Veränderungen in der Häufigkeit von bekannten Viren mit der Zusammensetzung von Moskitoarten und ökologischen Veränderungen zu studieren. Nach und nach zeigte sich, wie viele unbekannte Viren sich bereits in den Insekten befinden, darunter zahlreiche insektenspezifische, die nicht in der Lage sind, Wirbeltiere zu infizieren. Anhand der Studien lassen sich Modelle entwickeln, die Ausbreitungsprozesse darstellen. Viren, von denen man bisher nichts wusste, finden sich in intakten Ökosystemen viel häufiger als etwa das Dengue- oder Gelbfieber-Virus.
Stoßen Sie bei Ihrer Suche auch auf Ursprungsvarianten von bereits bekannten Viren, die mittlerweile pathogen sind?
Das kann man auf verschiedenen Ebenen haben, also ganz weit zurückliegende Ursprungsvarianten. Zum Beispiel haben wir bei Bunyaviren – ein bekanntes Bunyavirus ist das Rifftal-Fieber-Virus (RVFV), das hämorrhagisches Fieber bei Rindern und Menschen auslösen kann – viele tiefe phylogenetische Linien, die zu späteren Zeitpunkten als neue Familien klassifiziert wurden, in Mücken im Regenwald gefunden. Dadurch konnten wir belegen, dass sich die humanpathogenen Bunyaviren aus insektenrestringierten Bunyaviren entwickelt haben. Das ist ein sehr langer evolutionärer Zeitraum. Ein Beispiel für einen kürzeren evolutionären Prozess ist das St.-Louis-Enzephalitis-Virus, das 1933 in St. Louis zum ersten Mal entdeckt wurde. Die Herkunft blieb lange unklar. Bei einem unserer Forschungsprojekte haben wir in Südmexiko an der Grenze zu Guatemala im Regenwald Mücken gefangen. In diesen Mücken fanden wir eine Vorläufervariante des Virus. Mit phylogeografischen Analysen konnten wir dann zeitlich und örtlich zeigen, wie sich das Virus von Zentralamerika im 17. Jahrhundert zur Zeit des Sklavenhandels und dem Beginn der Abholzung des Regenwaldes ausbreitete und mit den Schiffen nach Nordamerika transportiert wurde. Zunächst nach New Orleans und dann den Mississippi hoch bis nach St. Louis.
Wie genau funktioniert das Fangen/Einsammeln von Stechmücken?
Wir benutzen drei verschiedene Fallen. Alle Fallen sind mit Akkus betrieben und haben einen kleinen Ventilator. Hinter dem Ventilator sind Fangnetze mit verschiedenen Duftstoffen, die Moskitos anlocken. Die Mücken fliegen dann in das Netz, das wir zweimal täglich leeren. Die Logistik ist ziemlich aufwendig, da unsere Arbeit ja in unerschlossenen Gebieten geschieht. Wir müssen unser gesamtes Equipment in das Gebiet transportieren. Teilweise müssen die Fallen auch mit Seilen in Baumkronen hochgezogen werden, weil sich manche Mückenarten im hohen Bereich aufhalten, da sie nur an Vögeln oder bestimmten Affenarten saugen.
Wie ist das weitere Vorgehen, wenn die Mücken gefangen sind?
Im Labor identifiziert man zunächst die Art. Im Anschluss wird die Mücke homogenisiert. Ein Teil von dem Homogenat wird zur Infektion von Zellen verwendet, und mit einem anderen Teil wird mit verschiedenen genetischen Testsystemen das Genom von Viren nachgewiesen.
Ist es wichtig, dass die Viren noch keinen Kontakt zu Menschen gehabt haben?
Wir wollen zum einen die, die noch keinen Kontakt hatten. Zum anderen jedoch auch diejenigen, die bereits Kontakt hatten, um sie miteinander zu vergleichen. Deshalb fangen wir Mücken in Gebieten mit intaktem Ökosystem, in die keine Menschen kommen. Wir fangen aber auch Mücken in angrenzenden Plantagen und Dörfern.
Menschen dringen immer weiter in bislang unberührte Ökosysteme vor. Ist Ihre Arbeit gewissermaßen so etwas wie ein Wettlauf gegen die Zeit?
Teilweise stehen die Gebiete, in denen wir forschen, unter Naturschutz. Die nicht streng geschützten Gebiete werden jedoch immer kleiner. Das ist äußerst problematisch. Was man beispielsweise dieses Jahr in Brasilien sieht, kann man nur als schrecklich bezeichnen.
Ihr Projekt ARBOSPREAD forscht hauptsächlich in Uganda. Weshalb?
Wir wollen generelle Mechanismen ableiten, also analysieren, welche Effekte möglicherweise bei ökologischen Veränderungen immer auftreten. Dazu müssen wir verschiedene Ökosysteme miteinander vergleichen. In Uganda hat man die Hauptökosysteme, die in Afrika vorkommen allesamt in räumlicher Nähe: Savanne, Galeriewald, Flachlandregenwald und Bergregenwald. Alle kommen in West-Uganda vor, so dass man keine weiten Wege hat, um die Effekte miteinander zu vergleichen.
Weshalb stammen viele Viren, die zoonotische Infektionskrankheiten beim Menschen ausgelöst haben, vom afrikanischen Kontinent?
Die Biodiversität in Afrika ist sehr hoch. Und Viren benötigen Wirte, um sich vermehren zu können. Es ist naheliegend, dass dort, wo viele verschiedene Wirtsarten leben auch viele verschiedene Viren vorhanden sind. In den letzten Jahrzehnten fanden starke ökologische Veränderungen in Afrika statt. Hinzu kommen Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und der sehr starke Landnutzungswandel. Menschen dringen also immer weiter in Ökosysteme vor – und ermöglich so den Virenübergang. Wenn wir die ökologischen Veränderungen in Südamerika beobachten, könnte es natürlich sein, dass von hier aus noch einige Infektionskrankheiten kommen werden.
Ist das voranschreitende Artensterben eventuell eine Barriere für die Ausbreitung von Viren oder begünstigt das Artensterben die Ausbreitung sogar noch?
Artensterben begünstigt die Ausbreitung von Viren. Man kann sich das so vorstellen, dass in einem intakten Ökosystem eine Art Gleichgewicht herrscht. Alle Tiere stehen miteinander in Bezug und beeinflussen sich gegenseitig in ihrem Vorkommen, wie etwa bei einer Räuber-Beute-Beziehung. Die Erreger, die in diesen Tieren vorkommen, sind ebenfalls im Gleichgewicht. Sie springen nicht einfach von Art zu Art, sondern sind artspezifisch. Wenn es jetzt zu Veränderungen des Systems kommt und Arten aussterben, nimmt das Vorkommen anderer Arten zu. Diese Arten sind sehr anpassungsfähig. Ihre Erreger breiten sich mit ihnen aus. Entweder sind diese Erreger ebenfalls anpassungsfähiger oder sie erhalten bedingt durch ihre Zunahme sozusagen öfter die Chance Mutationen zu entwickeln. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie auf einen anderen Wirt übergehen.
Artensterben erhöht also die Gefahr einer Epidemie oder gar Pandemie?
Ganz klar: ja. Neue Krankheitserreger haben es leichter, wenn etwas bereits modifiziert und vereinfacht wurde und die ursprüngliche Komplexität nicht mehr vorhanden ist.
Haben die klimatischen Bedingungen Einfluss auf die Ausbreitung von Viren?
Das Klima stellt eine natürliche Grenze der Ausdehnung bestimmter Viren dar. Verschiebt sich diese Grenze, verschieben sich mit ihr auch die der Viren, die auf diese Bedingungen angewiesen sind. Die Erreger können sich also besser ausbreiten.
Wie häufig sind Sie selbst in Uganda, um Proben zu sammeln?
Da ich Mutter eines kleinen Kindes bin, nicht mehr so häufig wie früher. Mindestens einmal im Jahr versuche ich an dem Ort zu sein, wo meine Projekte sind. Ansonsten sind dort meine Doktoranden und Post-Docs.
Wenn man sich die Experten dieser Tage anschaut, hat man den Eindruck, dass Frauen in der naturwissenschaftlichen Forschung noch immer stark unterrepräsentiert sind. Täuscht dieser Eindruck oder gibt es da Ausbaubedarf?
Der Anteil an Frauen im naturwissenschaftlichen Nachwuchsbereich ist sehr hoch. Ich denke, langsam aber sicher gleicht sich der Frauenanteil demjenigen der Männer an. Wir sind hier also auf einem guten Weg…
Das Gespräch führte Christoph Kohlhöfer